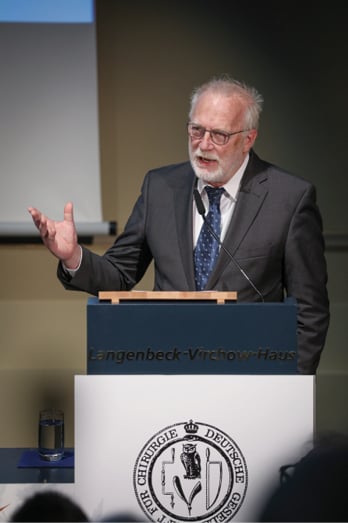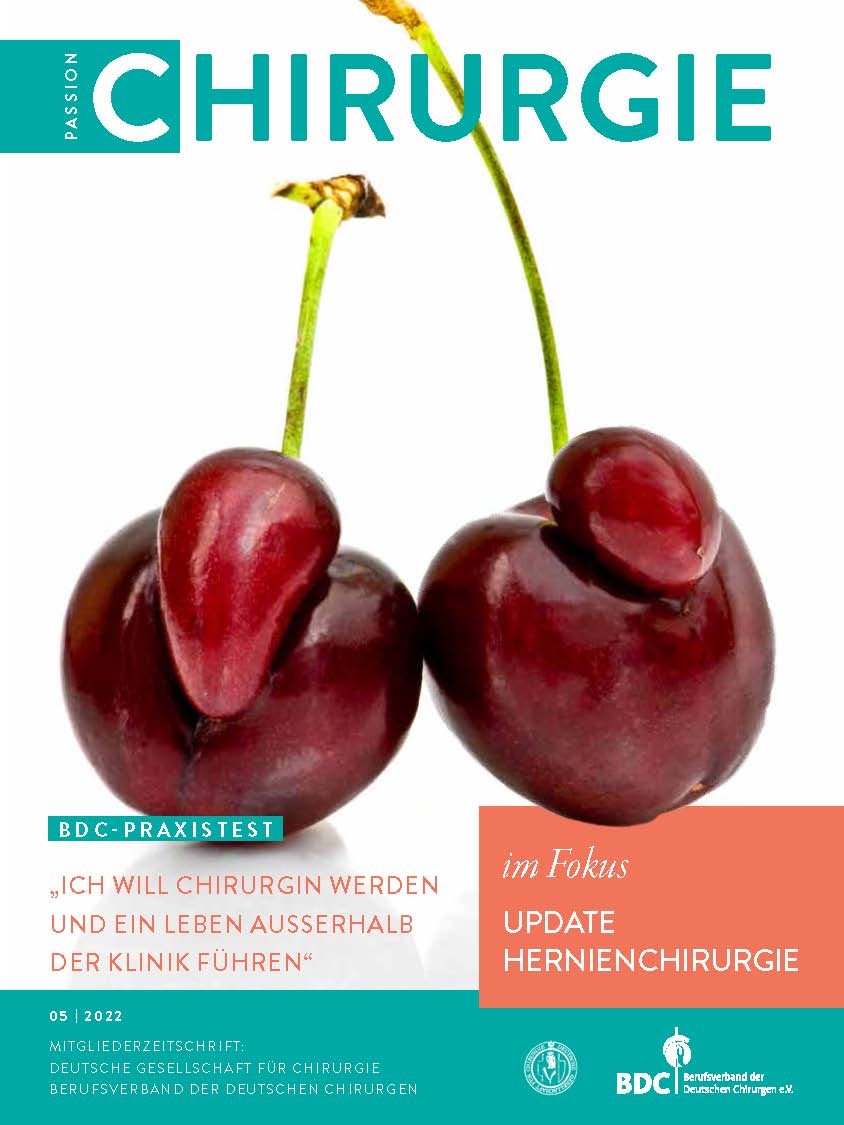01.06.2024 INTERN DGCH
Eröffnungsrede zum 141. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
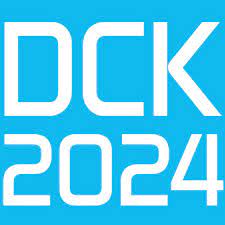
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Gäste,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
die aktuellen Zeitgeschehnisse der letzten drei Jahre führen dazu, dass die Weltpolitik zunehmend unruhiger wird. Unsere wichtigsten Werte wie Frieden, Freiheit und gesundheitliches Wohlergehen jedes Einzelnen in den westlichen demokratischen Ländern sind auf einmal gefährdet und nicht mehr selbstverständlich gegeben.
Die Menschen sind verunsichert und damit zunehmend skeptisch gegenüber Veränderungen im Leben.
Nun steht uns aktuell im Gesundheitssystem eine längst überfällige Reform bevor. Die deutsche Krankenhauslandschaft wird geprägt sein durch tiefgreifende Strukturreformen mit Zentralisierung hoch spezialisierter Medizin, zunehmender Ambulantisierung mit notwendiger transsektoraler Zusammenarbeit sowie flächendeckender Digitalisierung. Das wird zu massiven Veränderungen bei allen Beteiligten im Gesundheitssektor führen.
Im 152. Jahr des Bestehens der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie zählt in Anbetracht dieser anstehenden Veränderungen mehr denn je der Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft, um gemeinsam die notwendigen gesundheitspolitischen Reformen beratend zu flankieren.
Ich gehe soweit und sage, nur zusammen haben wir überhaupt eine Chance, in der Landes- und Bundesgesundheitspolitik auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und können so dazu beitragen, die zukünftige medizinische Versorgung unserer Gesellschaft sicherzustellen.
Gemeinsam müssen wir darauf achten, dass die durch Forschung und Wissenschaft geschaffenen Werte, nicht verloren gehen, und dass Fortschritt nur durch Wissenschaft und Forschung zustande kommt. Wissenschaftsnahe Medizin wird immer den Anspruch haben, Therapien zu verändern beziehungsweise zu verbessern. Wissenschaftsnahe Medizin ist aber auch Innovation und Wertschöpfung.
Zurzeit versorgen knapp 6 Millionen Beschäftigte tagtäglich mit großem Engagement bestmöglich Patientinnen und Patienten. Bestmöglich heißt dabei aber, so gut wie es die Rahmenbedingungen zulassen, die geprägt sind durch Fachkräftemangel, unausgereifte Digitalisierung verbunden mit unstrukturierter transsektoraler Patientensteuerung. Wie kaum ein anderer Wertschöpfungssektor steht unser Gesundheitssystem vor tektonischen Verschiebungen im Kontext von demographischem Wandel, Digitalisierung und patienten-zentrierter Versorgung.
Bund und Länder können sich nur schwer auf den richtigen gemeinsamen Weg einigen und diskutieren viel – sicher wichtig – aber verlangsamen damit den schon längst überfälligen Prozess der Reformierung.
Besonders bedrückend ist dabei, dass in vielen Krankenhäusern die Existenzangst umgeht, dass eine bislang nicht da gewesene Insolvenzwelle heranrollt. Insofern sind sämtliche Reformvorhaben in unserem Gesundheitssystem auch große Sozialprojekte.
Zukünftig werden alle chirurgischen Fächer durch Einsatz modernster Technologie Next-Generation-Robotics, künstliche Intelligenz und virtuelle Realitäten geprägt sein. Das gelingt uns nur durch das Mitwirken einer motivierten jüngeren Generation in Forschung und Entwicklung dieser Technologien in Zusammenarbeit mit den industriellen Partnern.
Wie gelingt uns aber in Zukunft eine Krankenversorgung, die patienten-, bedarfs- und evidenzbasiert ist, die den demographischen Wandel berücksichtigt, die sich klinisch und wissenschaftlich international vorzeigen lässt und den Nachwuchs motiviert und fördert?
Das ist eine Mammutaufgabe. Ja, aber wir müssen sie gemeinsam angehen.
Eine ganz entscheidende Rolle spielt dabei der medizinische Nachwuchs. Die große Frage ist: wird es in Zukunft noch genügend motivierte Chirurginnen und Chirurgen geben, um unsere Patienten qualifiziert zu versorgen? Was müssen wir bieten, um Studierende von der operativen Medizin als Berufswahl zu begeistern?
Fragt man Medizinstudierende welche Facharztweiterbildung definitiv nicht in Frage kommt, so ist es Stand 2020 Chirurgie, Ortho/Unfall und Psychiatrie.
Wer oder was ist verantwortlich für diese Entwicklung? Die vereinfachte Antwort ist immer: die schlechten bzw. harten Arbeitsbedingungen. Es ist aber wesentlich vielschichtiger. Befinden wir uns nicht auch mitten in einem Generationenkonflikt zwischen Babyboomern/GenX vs. GenY/GenZ und wenn ja, wie kommen wir da heraus?
Ich möchte zu diesem Thema meine Gedanken ein wenig mit Ihnen teilen.
Denkt man über die vielschichtigen Zusammenhänge nach, kommt man vielleicht auch zu der Frage: liegt es ggfs. auch daran, dass den nachkommenden Generationen oder dem heutigen Zeitgeist in der Medizin so etwas wie Wettkampfbereitschaft fehlt oder anders: ist Wettkampf ggfs. gar nicht mehr notwendig – entsprechend wird er auch nicht mehr „erlernt oder vermittelt“ – und wird als das traditionelle Erfolgskonzept der alten Hierarchien abgetan.
Definitionsgemäß bedeutet Wettkampf oder Wettstreit lediglich die Auseinandersetzung um die beste Leistung in vielen Bereichen des Lebens, das kann sportliche, künstlerische, wirtschaftliche, politische oder andere kulturelle Leistungen betreffen.
Herman Nohl, ein bedeutender deutscher Philosoph und Pädagoge aus Göttingen, konstatiert, dass Wetteifer eine pädagogische Kategorie ist, die sich im frühesten Kindesalter manifestiert. Wettkampfbereitschaft liegt also tief in uns verwurzelt.
Ich würde gerne die Definition „Auseinandersetzung um die beste Leistung“ um das Wort „spielerisch“ ergänzen, denn das verbinde ich mit „Wetten“.
Wettkämpfe fanden bereits in prähistorischen Gesellschaften statt. Das beste Beispiel für Wettkämpfe ist natürlich die Olympischen Spiele der Antike, die seit 776 v. Chr. in Griechenland dokumentiert wurden und bis heute die Krönung des sportlichen Wettbewerbs sind.
In Deutschland gibt es jetzt öffentliche Diskussionen um die Bundesjugendspiele, heftige Diskussionen, da nicht alle Jugendliche den 1. Platz im 100-Meter-Lauf machen können, und das wird als ausgrenzend empfunden. Ist diese Diskussion wirklich förderlich?
Es stellt sich dann aber auch die Frage: hat uns Wettkampf in der Medizin eigentlich weitergebracht?
Ich denke auf jeden Fall. Hier ein paar Beispiele:
- Der Wettlauf um die Entdeckung der DNA-Struktur (Watson, Crick, Franklin, Wilkins) führte zur Entdeckung der Doppelhelix-Struktur.
- Die Suche nach einem Impfstoff gegen Polio war erfolgreich und führte schließlich zur fast vollständigen Ausrottung der Erkrankung.
- Die Entwicklung von Organtransplantationen: In den 1960er und 1970er Jahren gab es einen intensiven Wettbewerb zwischen Chirurgen und Forschern um die Entwicklung und Verfeinerung der Organtransplantation, insbesondere von Niere, Leber und Herz. Dieser Wettbewerb trug dazu bei, dass die Organtransplantation zu einer der erfolgreichsten Behandlungsoptionen für viele Patienten wurde.
Welche Attribute gehören denn generell zur Wettkampfbereitschaft in allen Bereichen des Lebens und auch der Medizin?
Ich zitiere das ein oder andere Wort, Sie haben es sicher bereits einmal gehört oder diese Worte sind in Zielgesprächen mit Vorgesetzten gefallen:
- Zielstrebigkeit und Engagement
- Entschlossenheit, Ausdauer und Standhaftigkeit
- Flexibilität, Bereitschaft neue Wege zu gehen
- Teamgeist: Die Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten und die Fähigkeit, sowohl zu führen als auch zu folgen
- Selbstreflexion, reelle Selbstwahrnehmung: die Fähigkeit, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, um sich kontinuierlich weiter zu entwickeln.
Negativ betrachtet ist Wettkampf nur durch persönliche Eitelkeiten motiviert. Im Kontext des Wettkampfes bemühen sich Menschen besonders stark, besser abzuschneiden als andere, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu stärken oder sich gegenüber anderen überlegen zu fühlen.
Positiv betrachtet wird Wettkampfbereitschaft gesehen als Streben nach persönlicher Exzellenz oder Verbesserung und vor allem Spaß an der Herausforderung.
Die kritische Frage ist nun, inwieweit Wettkampfbereitschaft zwingend notwendig ist, um Exzellenz in der Medizin – insbesondere in der Chirurgie – zu erreichen.
Exzellenz in der Medizin kann durchaus möglich sein, auch ohne direkten Wettkampf gegeneinander im herkömmlichen Sinne, ohne dass ein direkter Wettkampf zwischen einzelnen Ärzten oder medizinischen Einrichtungen stattfinden muss.
Ein Beispiel aus der Wissenschaft ist das Team Ugur Sahin und Özlem Türeci, mittlerweile die Firma BioNTech, ein gemeinsamer, nicht untereinander konkurrierender Erfolgsweg in der Entwicklung von mRNA-Technologien und insbesondere dem COVID-19-Impfstoff. Gleichzeitig zeigt ihr gemeinsamer Lebensweg aber auch, dass inhaltlicher Wettkampf wesentliche Triebkraft für bahnbrechende Innovationen in der Medizin ist. Das Ehepaar wurde zusammen 2021 von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
Der medizinische Nachwuchs stellt sich heutzutage möglicherweise weniger einem direkten Wettkampf, weil sich die Dynamik in unserem Gesundheitssystem verändert hat. Früher war die Medizin noch hierarchischer strukturiert, es gab wenige Stellen für viele Bewerber, entsprechend war der Wettbewerb um begrenzte Stellen sehr intensiv und notwendig.
Heutzutage gibt es zunächst einmal wesentlich weniger Bewerber auf deutlich mehr attraktive Stellen, das heißt, Wettkampf um eine Stelle ist gar nicht mehr notwendig, Karriere ergibt sich von allein und existentielle Sorgen gibt es sowieso kaum.
Und damit komme ich erneut zu der eingangs gestellten Frage: Sind vornehmlich die Millennials also Generation Y und im weiteren dann auch die Generation Z weniger wettkampfwillig und dann – brauchen diese nachkommenden Generationen Wettkampf zukünftig überhaupt für exzellente operative Medizin?
Die Lebensweise und der Zeitgeist der Generationen Y und Z baut mehr auf kooperativen Ansätzen auf als auf interindividuellem Einzelwettkampf, um Ziele zu erreichen. Es wird viel mehr Wert auf Selbstverwirklichung und ein ausgewogenes, persönliches Leben gelegt. Wettbewerb wird eher als störend und hinderlich für die persönliche Entwicklung und die Lebensqualität empfunden.
Und sie sind gegenüber uns – und damit meine ich Babyboomer und Generation X – in digitalen Welten aufgewachsen und haben eine Vorliebe für soziale Medien. Diese Technologien fördern eine Kultur der Vernetzung und des Teilens.
Unsere Arbeitsbedingungen haben sich in den letzten Jahren zudem deutlich geändert, und zwar bedingt durch die Corona-Pandemie, nämlich zu flexiblen Arbeitszeiten und Remote-Arbeit.
Auch das kann dazu beitragen, dass junge Menschen weniger Wettkampfdruck verspüren. Sie arbeiten projekt-basiert auf inhaltliche Ziele hin und stehen weniger in direkten Wettbewerb gegeneinander.
Ein Grund der geringeren Wettkampfbereitschaft ist, dass die nachkommenden Generationen erziehungsbedingt verlernt haben, mit Misserfolgen umzugehen und entsprechend Wettkampf meiden.
Ursachen dafür sind mangelnde Resilienzentwicklung oder auch das Aufwachsen in einer Welt der sofortigen Belohnungskultur in den sozialen Netzwerken.
Der norwegische Ex-Handballspieler Anders Indset stellt am Beispiel des so genannten Wikinger-Kodex dar, warum seiner Meinung nach norwegische Sportler so erfolgreich sind. Der „Wikinger-Kodex“ beschreibt eine neue, wertebasierte Leistungskultur in Norwegen in Sport und Wirtschaft, die Hochleistung mit Sinnstiftung zusammenbringt und ganz klar Leistung als etwas sehr Wichtiges erachtet und vor allem mit Spaß assoziiert.
In Hinblick auf die Zukunft der Chirurgie und die vielleicht nicht mehr so ausgeprägte Wettkampfbereitschaft für Exzellenz müssen wir uns also die folgenden Fragen stellen:
Wie schaffen wir es denn nun, die notwendige Anzahl hochqualifizierter Chirurginnen und Chirurgen zu entwickeln, um auch zukünftig den Bedarf einer exzellenten chirurgischen Versorgung unserer Bevölkerung zu decken?
Ich denke, wir müssen uns zum einen auf den neuen Zeitgeist einlassen – ich spreche hier jetzt absichtlich nicht mehr von den Generationen – und akzeptieren, dass es verschiedene Wege zum Erfolg und zu exzellenter Leistung gibt und nicht nur die althergebrachte Art der Leistungserbringung durch herkömmlichen Wettkampf gegeneinander um individuelle Anerkennung, Karriere oder Macht der Schlüssel zum Erfolg ist.
Bislang konnten die Vertreter des neuen Zeitgeistes – also die Millenials und die Generation Z – ja auch nur rudimentär beweisen, dass auch Wege ohne Wettkampf erfolgreich sein können.
Es ist unsere Aufgabe, den Nachwuchs so zu fördern, dass wir angepasst an den Zeitgeist, der eher auf Teamarbeit und kollegialem Austausch, als auf der Positionierung einzelner Wettkampfsieger basiert, die Leistungsfähigkeit der nachkommenden Generationen sicherstellen.
Das heißt, wir müssen unsere Konzepte der Leistungserbringung modernisieren, umdenken und an den Zeitgeist des Nachwuchses anpassen.
Des Weiteren benötigen wir auch klare Konzepte, um die sicher mangelnde Resilienz des Nachwuchses zu stärken. Wettkampfatmosphäre gegeneinander und wohlmögliche Misserfolge sind sicher nicht die Lösung.
Ganz entscheidend sind moderne, transparente Führungsstrategie mit klaren Strukturvorgaben und Routineabläufen, Zusammenhalt im Großen und Kleinen – Loyalität untereinander – und psychologische Sicherheit mit gegenseitigem Verantwortungsgefühl.
Wer Leistung fordert, muss Sinn geben! Das sagt der international anerkannte Dirigent Gernot Schulz, ein Berliner Philharmoniker sowie ehemaliger Assistent von Leonard Bernstein. Wer kann es besser beschreiben als ein Dirigent eines Orchesters!
Nur wenn das gemeinsame Ziel für jeden überzeugend veranschaulicht wird, identifizieren sich Mitarbeiter mit ihren Aufgaben. Und wenn sie das tun, entwickeln sie die Leidenschaft und Hingabe mit Lust auf Höchstleistung – auch ohne Wettkampf.
Auf der anderen Seite wird es meiner Ansicht nach klare „rote Linien oder nie zu ändernde Umstände“ für den Nachwuchs in den operativen Fächern geben.
Die Aus- und Weiterbildung in den operativen Fächer der Medizin ist naturgemäß mit einer höheren physischen und psychischen Belastung gepaart. Gefordert ist ein hohes Maß an Resilienz und Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen und einen notwendigen, strengen Ethik-Kodex. Das wird man nicht ändern können und die Bereitschaft dazu muss vorhanden sein.
Bitte verzeihen Sie mur den flapsigen Ausdruck: das Whippeln lernt man nicht im Homeoffice!
Es muss also beim Nachwuchs ein gesundes Maß an individuellem Antrieb und Leidenschaft geben, um die gewünschte exzellente Qualität in den operativen Fächern zu erreichen. Diese Leidenschaft wird zu Gunsten der operativen Fächer aktuell richtig geboostert durch die Entwicklungen in der Medizintechnik wie Robotic, KI und VR, das fasziniert den Nachwuchs, der in digitalen Welten und mit virtuellen Realitäten groß geworden ist.
Ich möchte abschließend betonen:
wir brauchen weiter ausgewogene Wettkampfbereitschaft unter dem Nachwuchs, gerne im Team, der inhaltlich getrieben ist und nicht primär durch Eigeninteresse, Karriereziele und Streben nach Macht und Anerkennung.
Das ist ein Appell an den Nachwuchs! Wettbewerbselemente in der Medizin wie Exzellenz-getriebene Vergabe von Forschungsgelder müssen bleiben, um Spitzenforschung in der Medizin und im Besonderen in der Chirurgie voranzutreiben. Und ich zitiere erneut den Wikinger-Kodex: Hochleistung macht Spaß!
Wir Aus- und Weiterbilder müssen uns aber mehr denn je auf den Zeitgeist des Nachwuchses einlassen und entsprechend angepasste Voraussetzungen zur Weiterbildung schaffen.
Wir sollten Teamgeist fördern und Wettkämpfe untereinander reduzieren. Und das ist ein Appell an uns: Wir sind verantwortlich für die Attraktivität einer Facharztausbildung in der Chirurgie und nicht ausschließlich das Klinikum, der Krankenhausträger, das Land, die Ärztekammern usw.
Wir alle müssen mehr für die Entbürokratisierung in unseren Institutionen kämpfen und eine positive Innovationskultur und eine risikobereitere, unternehmerische Denkweise fördern.
Das motiviert den Nachwuchs neben sinngebender Arbeit, transparenter Führungsstruktur sowie positionellen Perspektiven mit Sichtbarkeit in unserer chirurgischen Gemeinschaft.
Autor des Artikels
Prof. Dr. med. Christiane Bruns
Präsidentin der DGCH 2023/2024DirektorinKlinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Tumor- und TransplantationschirurgieUniversitätsklinikum Köln (AöR)Weitere Artikel zum Thema
01.08.2022 BDC|News
Grußwort zur 150 Jahre-Feier der DGCH
Es ist mir eine große Ehre und besondere Freude, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie die Glückwünsche und Grüße unseres Berufsverbandes zum 150-jährigen Jubiläum zu überbringen. Die Chirurgie hat in dieser Zeit ungeahnte und außergewöhnliche Fortschritte zum Wohle der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten erlebt. Operationen, die zu Gründerzeiten unvorstellbar waren und sogar als unverantwortlich abgelehnt wurden, sind heute weit verbreitete Praxis.
12.06.2022 BDC|News
Editorial 06/2022: Nachlese DCK Kongress 2022
zur diesjährigen Kongressausgabe unserer Mitgliederzeitschrift „Passion Chirurgie“ seien Sie herzlich willkommen! Wie jedes Jahr im Juni ist diese schwerpunktmäßig dem Deutschen Chirurgenkongress gewidmet, der nun zum 139. Mal vom 6. bis 8. April in Leipzig stattgefunden hat und dem erneut ein Präkongress (28. bis 30. März, online) vorausgegangen ist.
01.12.2021 Aus-, Weiter- & Fortbildung
Einladung zum DCK 2022
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Pflegekräfte, Studierenden und Partner aus der Industrie, hiermit möchte ich Sie im Namen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie zum 139. Kongress unserer Gesellschaft nach Leipzig (06. bis 08. April 2022) sehr herzlich einladen.
01.03.2021 INTERN DGCH
Einladung zum DCK 2021
Hiermit möchte ich und mein Organisationsteam Sie im Namen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und gemeinsam mit den Fachgesellschaften, die im Rahmen des DCK ihre Jahrestagungen oder Frühjahrstagungen ausrichten, herzlich zum 138. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie im Jahr 2021 nach Mainz einladen.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.