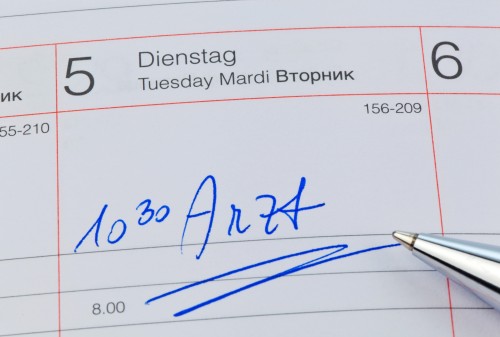Fehler passieren jedem – doch bei Ärzten kann ein Behandlungsfehler schnell schlimme Konsequenzen haben. Für ihr Buch „Der Fehler, der mein Leben veränderte“ hat die Autorin Gina Bucher unter anderem mit einer jungen Ärztin gesprochen, die einen folgenschweren Fehler gemacht und dafür die Verantwortung übernommen hat.
Ava Keller (Name geändert) heißt die junge Ärztin, die im ersten Kapitel des Buches zu Wort kommt. Keller arbeitet nach dem Studium als Ärztin im Praktikum auf der Krebs-Station eines norddeutschen Uniklinikums. Schon nach drei Monaten darf sie eigenverantwortlich Chemotherapien verabreichen – und ist dabei mit einer ähnlich unerfahrenen Kollegin allein, obwohl sie ihre Approbation noch nicht hat. Auf der Station gibt es verschiedene Ampullen für die Chemotherapie: Manche Substanzen werden in die Venen gespritzt, andere in das Rückenmark, damit sie ins Gehirnwasser gelangen. Doch Keller verwechselt diese beiden Spritzen – und merkt das auch direkt:
„Zuerst konnte ich überhaupt nicht einschätzen, wie schlimm das ist: Welche Konsequenzen hatte dieser Fehler für die Patientin? Ich suchte sofort meinen Kollegen vom Nachtdienst, der zum Glück noch da war. Er war deutlich erfahrener und alarmierte alle: den Neurologen, den Chef der Klinik, den Oberarzt. Sie verlegten die Patientin sofort auf die neurochirurgische Intensivstation, wo sie ihr das Gehirnwasser spülten. Niemand wusste, ob das klappen würde. Die Frau war ungefähr 73 Jahre alt und nicht sterbenskrank.“
Leben mit Schuld und Scham
Anfangs geht es der Patientin noch gut – doch dann beginnen die Lähmungen, und nach und nach werden sie immer schlimmer. Am Ende ist die Frau bis zum Hals gelähmt – ein Schwerstpflegefall. Und Keller bereut ihren Fehler zutiefst und muss mit der Schuld und der Scham leben. Sie stellt sich auch den juristischen Konsequenzen – sowohl in einem zivilrechtlichen Verfahren als auch in einem Strafprozess. Ihre Schuldgefühle verfolgen sie trotzdem bis heute – auch wenn sie weiter als Ärztin gearbeitet hat:
„Unterdessen, sechzehn Jahre später, weiß ich, dass es für mich richtig war, sofort wieder zur Arbeit zu gehen. Anfangs habe ich keinem davon erzählt. Weil ich mich so geschämt habe. Weil ich dachte, das kann ich keinem erzählen. Nur ein paar Kollegen haben das mitbekommen. Nach und nach haben es Freunde erfahren, auch meiner Familie habe ich es gesagt. Es hat mir keiner Vorwürfe gemacht, überhaupt nicht, zu keinem Zeitpunkt. Ich musste vor allen Dingen selbst damit klarkommen und für mich lernen, einen Fehler gemacht zu haben. Das zu lernen ist schwierig.“
Ein anderer Fall aus dem Buch betrifft die Krankenschwester Annemarie Rüter (Name ebenfalls geändert): Zwei Patienten, die sie in ihrem Berufsleben betreut hat, sind gestorben, nachdem die Schwester Fehler gemacht hat. Ob die Todesfälle tatsächlich mit diesen Fehlern zusammenhängen, bleibt zwar offen, doch die ehemalige Krankenschwester belasten sie sehr. Sie hat jahrzehntelang niemandem von den Vorfällen erzählt, will aber nun eine Selbsthilfegruppe für medizinisches Personal mit ähnlichen Erlebnissen gründen.

Zur Person
Gina Bucher studierte Publizistik und arbeitet als Redakteurin und freie Journalistin. Sie ist Herausgeberin verschiedener Bücher im Kunstbereich. Gina Bucher lebt in Zürich.
|
Buchautorin Gina Bucher im Interview
PASSION CHIRURGIE: Frau Bucher, für Ihr Buch haben Sie mit den Menschen, die Sie zu Wort kommen lassen, lange Gespräche geführt. Wie haben Sie z. B. die Ärztin und die Krankenschwester erlebt?
Gina Bucher: Die Ärztin hat sich in ihrer Psychotherapie stark mit dieser Geschichte auseinandergesetzt und auch im Strafverfahren wurde alles juristisch aufgearbeitet. Dennoch habe ich im Gespräch gemerkt, dass sie die Geschichte immer noch sehr, sehr betroffen macht. Sie hatte phasenweise auch Tränen in den Augen und hatte zum Teil große Mühe, darüber zu reden. Sie ist jetzt um die 40 und damit jünger als die Krankenschwester. Das macht bestimmt auch etwas aus. Ich hatte den Eindruck, die Krankenschwester hat ein großes Bedürfnis, diese Geschichten noch zu klären, bevor sie stirbt. Sie ist jetzt seit kurzem im Ruhestand und war auch sehr betroffen – aber bei ihr war es anders, weil diese Geschichten schon viel länger zurückliegen.
PC: Die Ärztin hat sich direkt mit dem Thema und den Folgen beschäftigt, die Krankenschwester hat es ein Leben lang geheim gehalten. Warum reagieren die Menschen so unterschiedlich auf ihre Fehler?
Bucher: Bei diesen beiden Geschichten muss man natürlich bedenken, dass sie in unterschiedlichen Jahrzehnten passiert sind. Bei der Krankenschwester reden wir über die 70er- und 80er-Jahre – damals wurde noch viel weniger über Fehler gesprochen. Bei der Ärztin ist es um das Jahr 2000 herum passiert. Sie meinte, damals hätte es immer noch gar keine Fehlerkultur gegeben. Heute sei das ein bisschen besser, sagt sie. Aber wie man mit Fehlern umgeht, ist auch ganz klar eine Typfrage. Ich weiß auch nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein erster Reflex wäre, erstmal alles zu vertuschen. Das ist wie bei der Fahrerflucht, dass man ganz anders reagiert, als man sich das vielleicht wünschen würde.
PC: Wie werden Fehler denn in Kliniken gehandhabt – und wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert?
Bucher: Von außen kann ich das natürlich nur schwer beurteilen. Aber ich habe gehört, dass sich die Kultur so langsam ändert. Es gibt immer mehr Meldesysteme, bei denen man sich als Arzt oder Pflegekraft melden kann. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, hier eine größere Offenheit zu entwickeln. Die Ärztin sagte in unserem Gespräch etwas Interessantes: dass die jungen Leute heute selbstbewusster sind und viel stärker einfordern, auch über solche Themen zu sprechen. Die Ärzte stecken da in einem Dilemma: Natürlich sind sie keine „Götter in Weiß“, sondern sie machen Fehler wie alle anderen auch – das wissen auch alle. Aber wenn man selbst behandelt wird, dann erwartet man natürlich schon, dass genau dann kein Fehler passiert – aber verhindern lässt es sich einfach nicht immer.
PC: Wie geht die Ärztin jetzt im Nachhinein mit diesem Dilemma um?
Bucher: Sie hat sich einen Arbeitsplatz gesucht, an dem sie eine bessere Kontrolle über die Abläufe hat und sich besser aufgefangen fühlt. So konnte sie die Risiken so gut wie möglich minimieren. Was sie jetzt weiß: Der Fehler, der ihr passiert ist, hätte verhindert werden können. Es gibt beispielsweise verschiedene Aufsätze, damit nur die richtigen Ampullen passen und andere gar nicht verwendet werden können. Das wusste sie aus einer anderen Klinik und hat es ihrem Arbeitgeber auch vorgeschlagen. Doch da wurde ihr knallhart gesagt: „Das machen wir nicht, weil die Klinik sonst zugeben würde, dass da ein Fehler passiert ist.“ Das hat die Ärztin sehr erschüttert – zusätzlich zu ihrer persönlichen Schuld.
PC: Wie haben Sie überhaupt Menschen gefunden, die so offen über ihre Fehler sprechen?
Bucher: Das war auch nicht so einfach. Die meisten Geschichten sind anonymisiert. Ich habe auf sehr unterschiedlichen Wegen nach diesen Personen gesucht: einerseits über Selbsthilfegruppen, aber auch über Psychologen, Sozialarbeiter, Juristen – all den Leuten, die mit solchen Menschen zu tun haben. In einzelnen Fällen ist es auch umgekehrt gelaufen, dass jemand von meinem Buchprojekt gehört hat und jemanden kannte oder sogar selbst eine Geschichte zu erzählen hatte. Ich habe nie jemanden überredet – das würde meinen Prinzipien widersprechen. Mir war wichtig, dass die Leute selbst erzählen wollen. Diese ganze Unsicherheit – soll ich davon erzählen oder soll ich nicht – das ist bei denen schon vorher passiert. Ich stelle mir vor, das gehört auch zu der Auseinandersetzung mit dem Thema. Das kann ja auch etwas Erleichterndes haben. Aber neben diesem Beicht-Effekt ging es auch vielen darum, dass der gleiche Fehler anderen nicht auch passiert. Die Ärztin beispielsweise wollte sehr gern aufklären und andere davor bewahren, weil sie selbst sehr stark darunter leidet.
PC: Gehen Männer und Frauen eigentlich grundsätzlich unterschiedlich mit Fehlern um?
Bucher: Es ist natürlich sehr individuell – sonst könnte ich einen Bestseller schreiben mit einer perfekten Anleitung, wie man damit umgeht. So ist es leider nicht (lacht). Aber ich glaube schon, dass Männer und Frauen – so pauschal man das jetzt sagen kann – unterschiedlich mit Fehlern umgehen. Das haben mir auch verschiedene Managerinnen bestätigt. Beispielsweise sprechen Männer gar nicht erst von „Fehlern“, sondern von „Erfahrungen“. Frauen sprechen viel häufiger von Fehlern und fragen auch schneller nach der Ursache. Sie fragen sich, wie sie in die Situation hineingeraten sind, während die Männer eher überlegen, wie sie aus der Lage wieder rauskommen. Beide Strategien haben natürlich ihre Vorteile, aber am besten wäre es, man könnte beide kombinieren. Es war für mich viel einfacher, Männer zu finden, die über ihre Fehler sprechen wollten. Vielleicht ist der Grund dafür, dass Männer mit ihren Fehlern leichter abschließen können.
PC: Was für Strategien helfen denn, mit dem Fehler abzuschließen?
Bucher: Was sicher hilft, ist, sich mit seinem Fehler auseinanderzusetzen. Das haben in der ein oder anderen Form alle Personen gemacht, mit denen ich für das Buch gesprochen habe: sich selbst knallhart ins Gesicht zu schauen und auszuhalten, was man da sieht. Wichtig ist, sich selbst gegenüber einzugestehen, dass man diesen Fehler gemacht hat und welche Konsequenzen dieser Fehler hat. Außerdem spielt für viele die Religion eine Rolle. Viele Gesprächspartner haben sich vorher nie für Religion interessiert, aber nach dieser Geschichte haben sie einen Zugang dazu gefunden. Ich glaube, die Religion kann eine wichtige Rolle spielen, weil sie einem die Möglichkeit gibt, wieder neu anfangen zu dürfen. In der Bibel handeln beispielsweise viele Geschichten von der urmenschlichen Erfahrung des Scheiterns – das kann sehr tröstlich sein.
PC: Welche Geschichte hat Sie am meisten beeindruckt?
Bucher: Es war gar nicht so sehr ein einzelner Mensch, der mich beeindruckt hat – sondern vielmehr die einzelnen Situationen. Beispielsweise in der Geschichte von dem Jugendlichen, der wegen mehrerer Raubüberfälle vor Gericht kam und dort auf seine Opfer traf. Er hat sich dort bei seinen Opfern entschuldigt und konnte gar nicht fassen, dass die Opfer ihm verzeihen konnten. Er hatte erwartet, dass alle wütend auf ihn sind und ihm eine möglichst lange Haftstrafe wünschen – aber so war es nicht. Das waren solche Erzählmomente, die mir eine richtige Gänsehaut beschert haben.
PC: Wie hat Ihr Buch Ihre eigene Einstellung zum Scheitern verändert?
Bucher: Eigentlich hat es mich wahnsinnig beruhigt. All die Gespräche, die ich geführt habe, haben wir gezeigt: Auch wenn einem ein krasser Fehler passiert, sind es immer Geschichten, die man auf handfeste Probleme runterbrechen kann und für die es oft konkrete Lösungsmöglichkeiten gibt. Im schlimmsten Fall kann man eine Strafe im Gefängnis absitzen oder ein Bußgeld bezahlen – man kann die Geschichte aber auch objektivieren und eine Distanz dazu entwickeln, zum Beispiel auch mit Selbstironie. In allen Geschichten, die ich gehört habe, sind viele helfende Hände vorgekommen. Bei der Ärztin gab es zum Beispiel einen Anwalt, der ihr einen großzügigen Rabatt gegeben und ihr damit sehr geholfen hat. Wenn einem ein Fehler passiert, gibt es kein „Schema F“, sondern man muss einfach improvisieren. Und das klappt auch oft, weil sich viele in der gescheiterten Person wiedererkennen und ganz unkompliziert Hilfe anbieten.

Buchtipp
Gina Bucher, Der Fehler, der mein Leben veränderte – Von Bauchlandungen, Rückschlägen und zweiten Chancen
© Piper Verlag GmbH, München, 2018
256 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN: 978-3-492-05599-4
Bucher G: Wenn ein Behandlungsfehler alles verändert. Passion Chirurgie. 2019 August, 9(08): Artikel 09.
Das Interview ist erschienen am 01.04.2019 auf der Webseite Operation Karriere, Deutscher Ärzteverlag GmbH. Zur Erstveröffentlichung