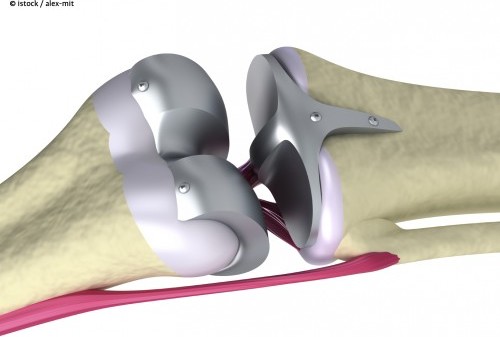Finanz-Reserven steigen auf rund 15 Milliarden Euro: Alle Kassenarten erzielen Überschüsse
Die gesetzlichen Krankenkassen haben im 1. Quartal 2016 einen Überschuss von 406 Millionen Euro erzielt. Dabei verzeichneten sämtliche Kassenarten ein positives Finanzergebnis. Die Finanz-Reserven der Krankenkassen stiegen bis Ende März 2016 damit auf 14,9 Milliarden Euro.
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: “Mit 15 Milliarden Finanz-Reserven, stehen die gesetzlichen Krankenkassen auch im Jahr 2016 auf einer sehr soliden Grundlage. Durch Augenmaß bei notwendigen Leistungsverbesserungen sowie mehr Prävention und Strukturverbesserungen machen wir unser Gesundheitswesen zukunftsfest und stärken nachhaltig seine Finanzierbarkeit. Das dient allen Versicherten.”
Einnahmen in Höhe von rund 55,82 Milliarden Euro standen nach den vorläufigen Finanzergebnissen des 1. Quartals 2016 Ausgaben von rund 55,41 Milliarden Euro gegenüber. Damit sind die Einnahmen je Versicherten um 4,3 Prozent und die Ausgaben je Versicherten um 3,2 Prozent gestiegen.
Die aktuelle Überschussentwicklung bei den Krankenkassen und die beim Gesundheitsfonds vorhandenen Finanz-Reserven bilden eine solide Ausgangsbasis für die Finanzentwicklung der GKV in 2016 und in den Folgejahren. Es kann auch für das Gesamtjahr 2016 vor allem auf Grund der günstigen konjunkturellen Lage mit einer weiterhin positiven Einnahmeentwicklung gerechnet werden. Ausgabenseitig blieben die moderaten Veränderungsraten im 1. Quartal deutlich niedriger als in der Prognose des Schätzerkreises für das Gesamtjahr 2016.
Finanzentwicklung nach Krankenkassenarten
Bei einer differenzierten Betrachtung nach Krankenkassenarten ergibt sich folgendes Bild: Die AOKen verzeichneten einen Überschuss von rund 72 Millionen Euro, die Ersatzkassen von 206 Millionen Euro, die BKKen von 38 Millionen Euro, die IKKen von 33 Millionen Euro und die Knappschaft-Bahn-See von 55 Millionen Euro.
Saisonüblicher Ausgabenüberhang beim Gesundheitsfonds
Zum Jahresende 2015 verfügte der Gesundheitsfonds über eine Liquiditätsreserve in einer Größenordnung von rund 10 Milliarden Euro. Der Gesundheitsfonds verzeichnete im 1. Quartal 2016 einen saisonüblichen Ausgabenüberhang von rund 2,5 Milliarden Euro. Im 1. Quartal 2015 betrug der Ausgabenüberhang noch rund 2,7 Milliarden Euro. Aus diesem saisonbedingten Überhang können keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung im weiteren Jahresverlauf gezogen werden.
Während die Ausgaben des Gesundheitsfonds als monatlich gleiche Zuweisungen an die Krankenkassen fließen, unterliegen die Einnahmen unterjährig erheblichen Schwankungen. Denn die Einnahmen aus der Verbeitragung von Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeldzahlungen fließen dem Gesundheitsfonds weitestgehend in der zweiten Jahreshälfte zu. Hinzu kommen erhebliche Zusatzeinnahmen, die aus den hohen Rentenanpassungen von 4,25 Prozent in den alten und 5,95 Prozent in den neuen Bundesländern zum 1. Juli resultieren. Durch die nach wie vor günstige Entwicklung der Beitragseinnahmen des Gesundheitsfonds profitiert die gesetzliche Krankenversicherung, wie die anderen Sozialversicherungszweige, auch weiterhin von der positiven Lohn- und Beschäftigungsentwicklung.
Moderate Ausgabenzuwächse
Je Versicherten gab es im 1. Quartal 2016 einen Ausgabenzuwachs von 3,2 Prozent, im 1. Quartal 2015 hatte der Zuwachs noch bei 4,2 Prozent, im Gesamtjahr 2015 bei 3,7 Prozent gelegen. Die Leistungsausgaben stiegen um 3,2 Prozent je Versicherten, die Verwaltungskosten um 3,3 Prozent. Deutlich steigende Versichertenzahlen haben dazu beigetragen, dass die Ausgabenzuwächse je Versicherten um rund 0,8 Prozentpunkte niedriger ausgefallen sind als die absoluten Ausgabenzuwächse. Dabei ist im 1. Quartal jedoch grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Ausgaben in vielen Leistungsbereichen in hohem Maße von Schätzungen geprägt sind, da Abrechnungsdaten häufig noch nicht vorliegen.
Entwicklungen in den einzelnen Leistungsbereichen
Nach Zuwächsen von 9,4 Prozent je Versicherten in 2014 und rund 4 Prozent in 2015 sind die Arzneimittelausgaben der Krankenkassen im 1. Quartal 2016 je Versicherten um 3,0 Prozent und absolut um 3,8 Prozent gestiegen. Bei den aktuellen Ausgabenzuwächsen ist zu berücksichtigen, dass die Ausgaben für innovative Arzneimittel zur Behandlung der Hepatitis C in den ersten drei Monaten 2015 insgesamt die höchsten Quartalsumsätze erzielten und im Vergleich dazu im 1. Quartal 2016 erheblich niedriger ausfielen. Durch Rabattvereinbarungen mit pharmazeutischen Unternehmern wurden die Krankenkassen weiterhin deutlich entlastet. Die Rabatterlöse sind im 1. Quartal 2016 um rund 8,4 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2015 auf rund 835 Millionen Euro gestiegen.
Im Bereich der vertragsärztlichen Vergütung stiegen die Ausgaben je Versicherten um rund 3,9 Prozent (absolut um rund 4,7 Prozent) an. Bei den Ausgaben für zahnärztliche Behandlung betrug der Anstieg je Versicherten 2,4 Prozent (absolut 3,2 Prozent), beim Zahnersatz 0,3 Prozent (absolut 1,1 Prozent). Da bei den Krankenkassen für das 1. Quartal in diesen Leistungsbereichen noch keine Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen vorliegen, haben die ausgewiesenen Veränderungsraten ausschließlich Schätzcharakter und lassen nur begrenzte Schlüsse auf die Ausgabenentwicklung im Gesamtjahr zu. Ein erheblicher Teil der Zuwächse bei der ärztlichen Vergütung dürfte auch auf Nachzahlungen im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung zurückzuführen sein.
Die Ausgaben für Krankenhausbehandlung stiegen im 1. Quartal 2016 je Versicherten um 2,4 Prozent (absolut um 3,2 Prozent) gegenüber dem 1. Quartal 2015. Insgesamt erhielten die Krankenhäuser hierdurch allein von den gesetzlichen Krankenkassen in den Monaten Januar bis März um rund 0,6 Milliarden höhere Finanzmittel, als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Buchungsumstellungen bei einer großen Krankenkasse zu Jahresbeginn haben dazu beigetragen, dass die Zuwachsrate insbesondere bei den Krankenhausausgaben im 1. Quartal vergleichswiese niedrig ausgefallen ist und im weiteren Jahresverlauf noch höher ausfallen wird. Außerdem konnten die mit dem Krankenhausstrukturgesetz verbundenen Verbesserungen bei der Finanzierung der Krankenhäuser im 1. Quartal bisher nur zu einem Teil finanzwirksam werden.
Beim Krankengeld sind nach mehreren Jahren mit hohen zum Teil zweistelligen Zuwächsen die Ausgaben mit einer Veränderungsrate von minus 0,1 Prozent je Versicherten (plus 0,8 Prozent absolut) erstmals gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu stabil geblieben. Dies setzt jedoch statistisch auf einer hohen Ausgabenbasis im 1. Quartal 2015 auf, in welchem noch eine Steigerungsrate von 8,2 Prozent zu verzeichnen war. Bereits ab dem 2. Quartal 2015 war eine deutliche Abflachung der Ausgabenentwicklung erkennbar.
Bei den Ausgaben für Präventionsleistungen nach §§ 20 ff. SGB V verzeichneten die Krankenkassen im 1. Quartal 2016 gegenüber dem 1. Quartal 2015 im Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von rund 73 auf rund 106 Millionen Euro (rund 45 Prozent). Die Ausgaben für Leistungen zur primären Prävention nach dem Individualansatz stiegen von 45 auf 54 Millionen Euro (17,5 Prozent), für betriebliche Gesundheitsförderung von 18 auf 27 Millionen Euro (38 Prozent) und für die Prävention in nichtbetrieblichen Lebenswelten von 9 auf 27 Millionen Euro (196 Prozent). Diese erfreuliche Entwicklung gerade in den betrieblichen und nicht-betrieblichen Lebenswelten, also in den Bereichen, in denen wichtige Weichenstellungen für ein gesundheitsbewusstes Leben vorgenommen werden können (z.B. in Kitas, Schulen und Betrieben), ist auf das neue Präventionsgesetz zurückzuführen, mit dem die Krankenkassen verpflichtet wurden, ihr bisher sehr geringes Engagement in den Lebenswelten deutlich auszubauen.
Die Netto-Verwaltungskosten der Krankenkassen sind im 1. Quartal 2016 mit 3,3 Prozent je Versicherten (4,2 Prozent absolut) nach insgesamt niedrigen Veränderungen in den Vorjahren weiterhin moderat gestiegen. Der Anstieg bewegt sich in ähnlicher Größenordnung wie der Anstieg der Leistungsausgaben insgesamt.
Quelle: Krankenkassen direkt, Postfach 71 20, 53322 Bornheim, http://www.krankenkassen-direkt.de, 22.06.2016