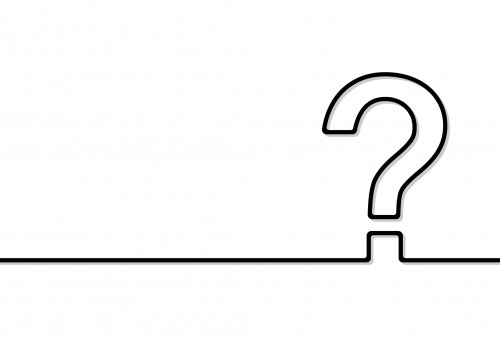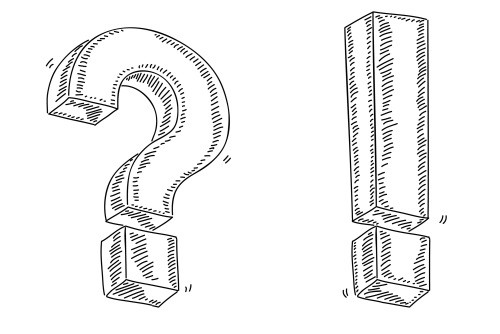Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI ist es für Beschäftigte und selbständig Tätige möglich, sich für die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, wegen der sie aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe (berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer sind, von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. Diese Vorschrift ist für Ärzte Rechtsgrundlage, um sich zu Gunsten der Mitgliedschaft im ärztlichen Versorgungswerk vollständig von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen zu können. Hierdurch wird eine doppelte Versicherungspflicht vermieden.
Nunmehr hat jedoch das Bundessozialgericht mit drei Urteilen (Az.: B 12 R 8/10 R, B 12 R 5/10 R und B 12 R 3/11 R) vom 31.10.2012 eine epochale Änderung in der Befreiungspraxis eingeläutet.
Von Bedeutung sind diese BSG-Entscheidungen für alle Pflichtmitglieder berufsständischer Versorgungswerke, die gleichzeitig aufgrund einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit pflichtversichert bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) sind. Hierzu zählen somit auch Ärzte.
Entscheidung des BSG – B 12 R 3/11
Aufgrund der Sachnähe wird allein auf dieses Urteil eingegangen.
In diesem Fall ging es um einen approbierten Arzt, der wegen seiner Tätigkeit als AiP seit 01.10.1997 von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit war. In der Folge war er sodann ab 01.12.1999 zunächst im Innendienst und sodann ab 01.05.2000 als Pharmaberater im Außendienst für ein pharmazeutisches Unternehmen tätig.
Das BSG hat in seinen Entscheidungen aufgrund enger Wortlautauslegung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI festgestellt, dass sich die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht stets nur auf die konkrete Beschäftigung bei einem konkreten Arbeitgeber oder die konkrete selbständige Tätigkeit des Betroffenen beschränkt.
Dies ergebe sich aus Sicht des BSG bereits aus dem eindeutigen Wortlaut der Regelung in § 6 Abs. 5 S. 1 SGB VI, der die Befreiung auf die „jeweilige“ Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit beschränke. Somit komme mit der Befreiungsentscheidung eine umfassende Befreiung von der Versicherungspflicht auch für andere als die „jeweils“ ausgeübte Beschäftigung des Betroffenen nicht in Betracht. Dies gelte selbst dann, wenn ursprüngliche und nachfolgende Erwerbstätigkeiten ähnlich sein mögen. Aufgrund dieses Gesetzeswortlauts werde die Reichweite der Befreiung von der Versicherungspflicht laut BSG gerade nicht über die konkreten inhaltlichen Merkmale der ausgeübten Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit, wie beispielsweise berufliche Qualifikation, beruflicher Status oder Berufsbezeichnung bestimmt. Sondern diese Vorschrift stelle ausschließlich auf die Rechtsbegriffe „Beschäftigung“ und „selbständige Tätigkeit“ ab, weshalb allein die konkrete Beschäftigung/selbständige Tätigkeit maßgeblicher alleiniger Anknüpfungspunkt für den Umfang der Befreiung sein könne.
Auswirkungen
Mit dieser Rechtsprechung erteilt das BSG der bisherigen Praxis der DRV und auch der Auffassung einiger Sozialgerichte, die den Begriff „jeweilige Beschäftigung/selbständige Tätigkeit“ in § 6 Abs. 5 Satz 1 SGB VI für manche Berufsgruppen im Sinne der „berufsgruppenspezifischen Beschäftigung“ unabhängig vom jeweiligen Arbeitgeber ausgelegt haben, eine klare Absage. Hiernach mussten diese Berufsgruppen bei einem Arbeitgeberwechsel in der Vergangenheit dann keinen neuen Befreiungsantrag stellen, wenn auch die neue Tätigkeit bestimmte Kriterien erfüllte. Der ursprüngliche Befreiungsantrag entfaltete dann auch hierfür Wirkung.
Das BSG definiert nunmehr jedoch die konkrete Beschäftigung über den jeweiligen Arbeitgeber, bei dem der Arzt zum Befreiungszeitpunkt angestellt war. Im Falle einer selbständigen Tätigkeit kommt es auf die tatsächlich ausgeübte selbständige Tätigkeit im Befreiungszeitpunkt an.
Konsequenz dieser Rechtsprechung ist, dass bei jedem Beschäftigungswechsel und bei jeder wesentlichen Änderung des Tätigkeitsfeldes die Befreiungswirkung endet und ein neuer Befreiungsantrag für die neue Beschäftigung/selbständige Tätigkeit bei der DRV gestellt werden muss.
Die DRV weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass als neu aufgenommene Tätigkeit in diesem Sinne sowohl jeder Arbeitgeberwechsel als auch jede wesentliche Änderung im Tätigkeitsfeld bei dem bisherigen Arbeitgeber anzusehen ist.
Allerdings ist aus Sicht des Verfassers noch nicht abschließend geklärt, wann eine wesentliche Änderung vorliegt. Die DRV geht derzeit nach aktuellster Mitteilung wohl davon aus, dass sich dies nach dem Berufsrecht, also der Bundesärzteordnung (BÄO) und der (Muster-)Berufsordnung (M-BO) bestimmt. Diese Rechtsauffassung ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt worden. Von einer wesentlichen Änderung im Tätigkeitsfeld sei dann nicht auszugehen, solange die Tätigkeit weiterhin dem in § 1 Abs. 2 M-BO festgelegten typischen ärztlichen Berufsbild (das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu leisten und an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken) entspreche. Nachdem der Arztberuf gemäß §§ 2, 2a, 3 BÄO nur mit Approbation ausgeübt werden könne, müsse nach dieser Auffassung der DRV die befreiungsfähige Beschäftigung auch nach Tätigkeitsfeldänderung eine solche sein, deren Ausübung die Approbation voraussetze. Allerdings folge allein aus der Approbation noch keine ärztliche Tätigkeit.
Dies bedeutet nach Meinung des Verfassers, dass nur noch für kurativ-ärztliche Berufstätigkeiten, sprich für die eine ärztliche Approbation erforderlich ist, eine Möglichkeit zur Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bestünde und nicht mehr wie bislang für Tätigkeiten, deren Voraussetzung nur eine ärztliche Ausbildung war. Welche Umstände zu dieser geänderten Auffassung der DRV geführt haben ist derzeit unklar. Möglicherweise ist diese Ausfluss dreier jüngst ergangener Urteile des BSG vom 03.04.2014 (Az.: B 5 RE 13/14 R, B 5 RE 9/14 R, B 5 RE 3/14 R) zum Befreiungsanspruch für abhängig beschäftigte Syndikusanwälte. Das BSG hat darin zur Beurteilung der Frage, ob eine anwaltliche Tätigkeit vorliegt, auf die verfassungs- und berufsrechtliche Rechtsprechung zum Tätigkeitsbild eines Rechtsanwalts nach der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und damit auf das Berufsrecht abgestellt (vgl. Pressemitteilung BSG vom 03.04.2014, Medieninformation Nr. 9/14, http://www.bsg.bund.de/DE/03_Medien/02_Medieninformationen/medieninformationen_node.html). Allerdings liegen die schriftlichen Urteilsgründe hierzu noch nicht vor, weshalb der Verfasser derzeit keine rechtssichere Auskunft darüber erteilen kann, ob und inwieweit diese Rechtsprechung auch auf die Befreiungsmöglichkeit für Ärzte angewandt werden kann. Sollte diese Auffassung sich durchsetzen, müsste zukünftig ein Arzt, der sich befreien lassen will, im Rahmen seiner Beschäftigung wohl zumindest überwiegend kurativ-ärztlich tätig sein.
Indiz für die Notwendigkeit eines neuen Befreiungsantrags könne aus Sicht der DRV sein, wenn die Tätigkeitsfeldänderung eine arbeitsvertragliche Anpassung bedinge, wobei allein Veränderungen in der Organisationsstruktur ohne wesentliche Umgestaltung des Tätigkeitsinhalts, der Zuständigkeiten und der Verantwortlichkeiten nicht zu berücksichtigen seien.
Zur Verdeutlichung werden folgende Beispielsfälle aufgezeigt, die der wohl derzeitigen, aber noch nicht offiziell bestätigten Rechtsauffassung der DRV entsprechen:
– Der Wechsel eines Arztes im Krankenhaus von einer Station auf die andere oder vom Stationsarzt zum Oberarzt bzw. Chefarzt stellt aus Sicht der DRV keine wesentliche Änderung des Tätigkeitsfeldes dar, unabhängig von einer Arbeitsvertragsänderung (vgl. zudem DRV „Änderungen im Befreiungsrecht der Rentenversicherung“, Stand 10.01.2014, http://www.deutsche rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/05_fachinformationen/01_aktuelles_aus_der_rechtsprechung/bsg_aenderungen_im_befreiungsrecht_der_rv.html).
– Dies gilt auch für den in Weiterbildung befindlichen Arzt, für den eine Befreiung für seine ärztliche Tätigkeit in einer Praxis oder im Krankenhaus vorliegt, solange als Facharzt kein Arbeitgeberwechsel im klassischen Berufsfeld stattfindet.
– Hingegen beurteilt die DRV den Fall anders, in dem ein Arzt neben seiner ärztlichen Haupttätigkeit zeitweise oder dauerhaft bei einem anderen Arbeitgeber eine ärztliche Nebentätigkeit ausübt. Für diese Nebentätigkeit benötigt der Arzt eine neue Befreiung.
– Ebenso verhält es sich aus Sicht der DRV, wenn ein selbständiger Arzt, der grundsätzlich mangels Versicherungspflicht für seine selbständige Tätigkeit keine Befreiung erhält, neben dieser selbständigen Tätigkeit eine Angestelltentätigkeit ausübt. Für diese Angestelltentätigkeit ist dann ein Befreiungsantrag notwendig.
– Für die Konstellation, in der ein Arzt für denselben Arbeitgeber innerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses auch nicht dem typischen Berufsbild entsprechende Tätigkeiten übernimmt, ist nach Auffassung der DRV maßgeblich darauf abzustellen, welche Tätigkeiten innerhalb des einheitlichen Beschäftigungsverhältnisses überwiegen oder dessen Charakter bestimmen. Ein neuer Befreiungsantrag ist somit dann zu stellen, wenn diese Abwägung zu Gunsten der nicht dem typischen Berufsbild entsprechenden Tätigkeiten ausfällt, sprich diese überwiegen.
Inwieweit die DRV diese Rechtsauffassung zur Befreiungsfähigkeit nur rein kurativ-ärztlicher Berufstätigkeit offiziell bestätigen wird und bei welchen Kriterien vor allem die sozialgerichtliche Rechtsprechung zukünftig eine wesentliche Änderung des Tätigkeitsfeldes annehmen wird, bleibt abzuwarten. Dies kann derzeit nicht vorhergesagt werden, sodass eine gewisse Rechtsunsicherheit bestehen bleibt.
Hinsichtlich der Antragstellung ist zu beachten, dass diese innerhalb von drei Monaten ab Beginn der neuen Tätigkeit bzw. ab Wechsel des Tätigkeitsfeldes erfolgen muss. Denn nur in diesem Fall wirkt die Befreiung zurück auf den Zeitpunkt der Beschäftigungsaufnahme bzw. des Wechsels des Tätigkeitsfeldes.
Andernfalls gilt die Befreiung erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung, wodurch es zu einer Doppelversicherung kommt, die es zu vermeiden gilt. Selbstverständlich kann ein neuer Befreiungsantrag auch schon vor Beginn der Beschäftigung bzw. vor dem Tätigkeitswechsel gestellt werden.
Behandlung sog. Altfälle (Beschäftigungsaufnahme vor dem 31.10.2012)
Fraglich ist zudem, wie sog. Altfälle, also Fälle mit Beschäftigungswechsel vor dem Zeitpunkt der Urteile des BSG am 31.10.2012 behandelt werden.
Auch hier verfolgt das BSG in seinen oben genannten Urteilen vom 31.10.2012 einen zu § 6 SGB VI entsprechenden Prüfungsansatz, wonach auch § 231 SGB VI für die fortdauernde Wirkung einer früheren Befreiung auf die konkrete Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit abstelle und eine Identität der Beschäftigung oder der selbständigen Tätigkeit, die während der ursprünglichen Befreiung von der Versicherungspflicht verrichtet wurde, fordere, indem die Fortwirkung einer vor dem 1.1.1992 erteilten Befreiung von der Versicherungspflicht nur hinsichtlich „derselben“ Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit möglich sei (vgl. BSG, 31.10.2012, Az. B 12 R 5/10 R). Dies bedeutet nach Meinung des Verfassers im Ergebnis, dass das BSG hier einen Bestandsschutz für Altfälle in diesem Urteil verneint.
Die DRV vertritt hingegen die Auffassung, dass für berufsständisch Versorgte, die in der Vergangenheit für die Ausübung einer klassischen berufsspezifischen Tätigkeit befreit worden waren und nach einem Arbeitsplatzwechsel vor dem 31.10.2012 eine derartige Tätigkeit weiterhin ausüben, Vertrauensschutz für die Dauer dieser aktuellen Beschäftigung besteht. Die DRV ging in der Vergangenheit davon aus, dass eine einmal erteilte Befreiung bei einem Arbeitgeberwechsel gültig blieb, wenn der neue Arbeitgeber bestimmte Kriterien erfüllte und eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt wurde. Die bisherige Praxis wird somit auf diese Fälle bei der aktuellen Beschäftigung von der DRV weiter angewandt. Soweit also Ärzte, die eine ärztliche Tätigkeit in Krankenhäusern oder Arztpraxen ausüben, ihre derzeitige Beschäftigung/Tätigkeit vor dem 31.10.2012 aufgenommen haben, müssen diese hiernach aus Sicht des Verfassers keinen neuen Befreiungsantrag stellen. Folglich muss erst bei einem weiteren Beschäftigungswechsel zwingend ein neuer Befreiungsantrag gestellt werden. Für die aktuell ausgeübte Beschäftigung kann jedoch eine Antragstellung zur Klärung erfolgen (vgl. DRV, a. a. O.).
Dieser Vertrauensschutz gilt nach Auffassung der DRV jedoch nicht für vor dem 31.10.2012 aufgenommene Beschäftigungen bei Ausübung einer anderen berufsspezifischen Tätigkeit. Dies betrifft Fälle, in denen eine Befreiung für die Ausübung einer berufsspezifischen Beschäftigung oder Tätigkeit zuerkannt worden war, vor dem 31.10.2012 jedoch durch einen Arbeitsplatzwechsel von dieser Beschäftigung oder Tätigkeit abgewandt wurde. Nachdem gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI nur berufsspezifische Tätigkeiten einer Befreiung zugänglich sind, war maßgeblich für den neuen Befreiungsantrag die konkrete Arbeitsplatzbeschreibung (vgl. DRV, a. a. O.). Dies bedeutet somit nach Ansicht des Verfassers, dass in solchen Fällen ein neuer Befreiungsantrag zu stellen ist.
Folglich ist aus juristischer Sicht zwingend zu empfehlen, sofern kein aktueller Befreiungsbescheid bzw. keine schriftliche Bestätigung der DRV über die Weitergeltung der ursprünglichen Befreiung für die aktuell ausgeübte Beschäftigung vorliegt, die Antragstellung nachzuholen, damit die Beschäftigung beurteilt werden kann. Denn möglicherweise ist diese als berufsspezifisch einzuordnen.
Liegen die Befreiungsvoraussetzungen vor, wird ab dem Datum der Antragstellung die Befreiung erteilt. Nach Auskunft der DRV sind weder zukünftig noch für die Vergangenheit die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für diese Beschäftigung zu zahlen, damit ein lückenloser Schutz durch die berufsständische Versorgungswerke gewährleistet werde (vgl. DRV, a. a. O.).
Aus den aktuellen Urteilen des BSG vom 03.04.2014 lässt sich zwar entnehmen, dass das BSG wohl nunmehr die Auffassung vertritt, dass die Inhaber einer begünstigenden Befreiungsentscheidung ein rechtlich geschütztes Vertrauen in den Fortbestand dieser Entscheidung hätten. Denn die Inhaber hätten Lebensentscheidungen über die Altersvorsorge getroffen, weshalb einer Änderung der Rechtsauffassung hinsichtlich ergangener Befreiungsentscheidungen grundsätzlich und in aller Regel keine Bedeutung zukommen könne (vgl. Pressemitteilung BSG vom 03.04.2014, a. a. O.). Allerdings kann mangels Vorliegen der Urteilsgründe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden, ob das BSG auch den Vertrauensschutz in die Befreiung auch bei einem Arbeitgeberwechsel oder einer Änderung der Tätigkeit bejaht.
Empfehlung
Nachdem derzeit nach Kenntnis des Verfassers zum einen noch nicht abschließend geklärt ist, wann eine wesentliche Änderung des Tätigkeitsfeldes vorliegt, ist aus juristischer Sicht dringend anzuraten, bei einem innerbetrieblichen Aufgaben- oder Funktionswechsel sicherheitshalber einen neuen Befreiungsantrag zu stellen. Zum anderen ist trotz der scheinbar eindeutigen Auffassung der DRV dennoch bis zum Eintritt einer rechtssicheren Lage sowohl bei Alt- als auch bei Neubefreiungen zu empfehlen, sich mit dem zuständigen Versorgungswerk bzw. mit der DRV in Verbindung zu setzen, um abzuklären, ob eine aktuell wirksame Befreiung für die aktuell ausgeübte Beschäftigung/Tätigkeit vorliegt und zur Sicherheit einen Befreiungsantrag zu stellen.
Sollte im Rahmen einer Betriebsprüfung weder ein alter noch ein aktueller Befreiungsbescheid für den Arbeitnehmer in den Unterlagen des Arbeitgebers vorliegen, werden die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung für den vergangenen Zeitraum unmittelbar eingefordert. Es kann hier zu hohen Nachforderungen seitens der gesetzlichen Rentenversicherung kommen, wenn kein positiver aktueller Befreiungsbescheid vorgelegt werden kann. Dies gilt es folglich zu vermeiden.