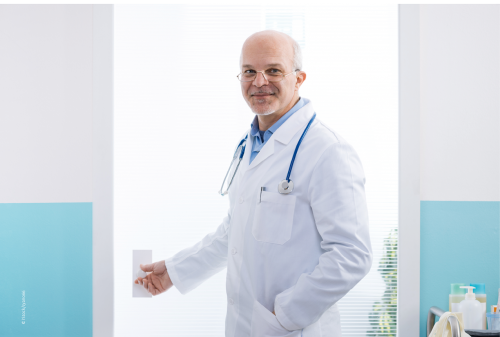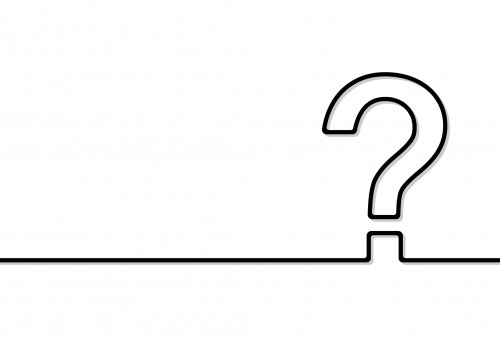Niedergelassene Vertragsärzte, die in Krankenhäusern auf freiberuflicher Basis allgemeine Klinikleistungen, insbesondere Operationen, durchführen, sind aus dem Alltag vieler Krankenhäuser nicht mehr wegzudenken. Auch für die niedergelassenen Ärzte eröffnet solch eine Honorararzttätigkeit weitere, sowohl fachliche als auch wirtschaftliche, Möglichkeiten. Allerdings birgt dies natürlich ein weiteres Risiko im Hinblick auf eine Haftungserweiterung für beide Seiten.
Definition „Honorararzt“
Eine Legaldefinition des Begriffs „Honorararzt“ gibt es bislang nicht. Die Bundesärztekammer definiert den Honorararzt als externen Facharzt, der in einer medizinischen Einrichtung zeitlich befristet und auf freiberuflicher Basis persönlich ärztliche Leistungen erbringt und hierfür von der Einrichtung eine Vergütung erhält. Sein Einsatz ist sowohl in ambulanter als auch stationärer Versorgung möglich.
Der Bundesgerichtshof versteht darunter gemäß seinem Urteil vom 16.10.2014, welches sich konkret auf die Kooperation mit einem Krankenhausträger bezog, einen Facharzt, der im stationären und/oder ambulanten Bereich des Krankenhauses ärztliche Leistungen für den Krankenhausträger erbringt, ohne bei diesem angestellt oder als Belegarzt oder Konsiliararzt tätig zu sein. Er wird zeitlich befristet freiberuflich auf Honorarbasis tätig, wobei das Honorar mit dem Krankenhausträger frei und unabhängig von den Vorgaben der GOÄ vereinbart wird und mangels Anstellung des Honorararztes keinen tarifvertraglichen Bindungen unterliegt (vgl. BGH, Urteil vom 16.10.2014 – III ZR 85/14).
Diese beiden Definitionen unterscheiden sich somit von ihrem Inhalt her aus Sicht des Verfassers nicht wesentlich, wobei die vom BGH für den Krankenhausbereich aufgestellte Definition detaillierter und damit auch juristisch klarer ist.
Deliktische Haftung
Unabhängig von der Art der Behandlung, also ambulant oder stationär, sowie von der vertraglichen Situation zwischen Patient und Honorararzt besteht im Falle eines vorwerfbaren Behandlungsfehlers des Honorararztes zunächst stets die gesetzlich normierte Haftung des Arztes aus unerlaubter Handlung gemäß §§ 823 ff. BGB.
Der Honorararzt haftet danach für eigene Behandlungsfehler stets aus Delikt gemäß § 823 Abs. 1 BGB persönlich gegenüber dem Patienten.
Daneben ist eine Haftung der Einrichtung für fremde Fehler ihrer Verrichtungsgehilfen (z. B. sonstige Ärzte, Pflegepersonal) gem. § 831 Abs. 1 S. 1 BGB möglich. Allerdings steht der Einrichtung die Führung des sog. Entlastungsbeweises gem. § 831 Abs. 1 S. 2 BGB offen, wenn diese bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern sie Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
Vertragliche Haftung
Als weitere Anspruchsgrundlage zu Gunsten des Patienten kommt neben dem gesetzlichen Haftungstatbestand im Falle eines Behandlungsfehlers die Haftung aus dem Behandlungsvertrag zum Tragen. Hierbei ist stets die jeweilige vertragliche Konstellation zwischen der Einrichtung (Krankenhaus/MVZ/Praxis), dem Honorararzt und dem Patienten maßgeblich.
1) Ambulante Versorgung
Im Rahmen der ambulanten Versorgung kommt der Behandlungsvertrag ausschließlich mit der medizinischen Einrichtung zu Stande, also mit der Arztpraxis oder dem MVZ. Rechtlich kommt es damit zu einer alleinigen Haftung der Einrichtung nach Vertrag gegenüber ihren Patienten für ein schuldhaftes Handeln des Honorararztes. Denn Behandlungsfehler des Honorararztes werden der Einrichtung zugerechnet, da dieser deren Erfüllungsgehilfe gem. § 278 BGB ist.
Nicht vergessen werden darf dabei aber, dass selbstverständlich der Honorararzt, wie oben dargestellt, daneben aus Delikt gemäß § 823 Abs. 1 BGB haftet.
2) Stationäre Versorgung
Bei der stationären Versorgung ist zwischen den folgenden drei Vertragstypen zu unterscheiden:
- dem totalen Krankenhausaufnahmevertrag,
- dem totalen Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag und
- dem gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrag.
2. 1) Totaler Krankenhausaufnahmevertrag
a) Für die Haftung gilt zunächst im Rahmen eines totalen Krankenhausaufnahmevertrages, wie er in der Konstellation der Erbringung von Regelleistungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 KHEntgG durch den Honorararzt üblicherweise vorliegt, dass lediglich der Krankenhausträger dem Patienten gegenüber aus dem Behandlungsvertrag haftet, da dieser ausschließlich zwischen Krankenhaus und Patient zu Stande kommt. Das Krankenhaus ist danach nämlich verpflichtet, alle für die stationäre Versorgung des Patienten erforderlichen Leistungen, und somit auch sämtliche ärztliche Regelleistungen, zu erbringen. Zur Erfüllung der allgemeinen Krankenhausleistungen kann das Krankenhaus externe, nicht festangestellte Honorarärzte heranziehen (§ 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 KHEntgG). Dem Krankenhausträger wird deshalb auch das Verschulden des Honorararztes nach § 278 Satz 1 BGB zugerechnet. Ein eigenständiges Vertragsverhältnis zwischen dem Honorararzt und dem Patienten wird jedenfalls nicht begründet.
b) Wie sieht jedoch die Haftungsverteilung aus, wenn dem Honorararzt im Rahmen seiner niedergelassenen Praxistätigkeit bei einem Patienten, der dann später auch von ihm im Krankenhaus im Rahmen seiner Honorararzttätigkeit als Regelleistung operiert wird, sowohl ein Behandlungsfehler im Rahmen der niedergelassenen Praxistätigkeit als auch später bei der OP unterläuft? Mit Urteil vom 13.03.2018 – VI ZR 151/17 – hat der BGH nunmehr hierzu entschieden (siehe HIER).
Sachverhalt
In vorliegendem Fall verklagte die Haftpflichtversicherung des Krankenhausträgers den honorarärztlich tätigen Arzt auf Gesamtschuldnerausgleich, d. h. auf Zahlung der Hälfte des von der Haftpflichtversicherung an den geschädigten Patienten gezahlten Betrages.
Der beklagte Arzt behandelte in seiner Praxis den Patienten wegen seit Jahren andauernder Rückenschmerzen. Nach Durchführung eines Magnetresonanztomographie (MRT) wurde die weitere Behandlung inkl. einer möglichen Operation (OP) von ihm gegenüber dem Patienten erklärt. Nachdem der Patient sich zur OP entschieden hatte, führte der Arzt die Aufklärung in seiner Praxis durch. In der Folge wurde die vom beklagten Arzt gestellte OP-Indikation auch durch die orthopädische Abteilung des Krankenhauses anhand der Auswertung radiologischer, kardiologischer und allgemeinärztlicher Unterlagen überprüft. Etwas mehr als einen Monat nach dem Aufklärungsgespräch überprüfte auch der Arzt erneut die OP-Indikation. Zwei Tage später begab sich dann der Patient in die stationäre Behandlung des Krankenhauses, in dem der beklagte Arzt als Honorararzt tätig war. Der Arzt führte sodann im Rahmen seiner honorarärztlichen Tätigkeit die Operation durch. Zwei Tage nach der OP kam es zu einer Komplikation, in deren Folge eine Revisions-OP durch den Arzt notwendig wurde. Diese blieb jedoch erfolglos. Der Patient wurde dann verlegt und musste sich einem weiteren Revisionseingriff unterziehen, jedoch wurde ein beschwerdefreier Zustand nicht erreicht.
Im Honorararztvertrag zwischen Krankenhausträger und niedergelassenem Arzt war in § 6 vereinbart, dass sich die Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhausträgers auch auf die im Rahmen des Honorararztvertrages zu erbringenden ärztlichen Leistungen des Arztes bezieht. Für seine niedergelassene Tätigkeit besaß der Arzt eine eigenständige Haftpflichtversicherung.
Im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens zwischen Krankenhausträger und Patient wurde sodann festgestellt, dass sowohl Indikation als auch Aufklärung fehlerhaft gewesen waren. Zudem wurden die eigentliche OP sowie die erste Revisions-OP nicht fachgerecht vom Honorararzt durchgeführt. Hierdurch war dem Patienten ein Dauerschaden entstanden. Aufgrund dieses Ergebnisses schloss die Haftpflichtversicherung des Krankenhauses mit dem Patienten eine Abfindungsvereinbarung in Höhe von 170.000 Euro zzgl. dessen Anwaltskosten. Der Patient verzichtete dafür auf alle Ansprüche gegen das Krankenhaus und den Arzt. Des Weiteren zahlte die Haftpflichtversicherung an die gesetzliche Krankenkasse des Patienten einen Betrag in Höhe von 24.500 Euro im Hinblick auf den von dieser gemäß § 116 SGB X geltend gemachten Behandlungskostenregresses zurück. Die Hälfte dieser gezahlten Beträge verlangte die Haftpflichtversicherung des Krankenhauses nunmehr vom Arzt zurück, indem sie sich auf einen Erstattungsanspruch aus einem behaupteten Gesamtschuldverhältnis berief (vgl. zu alldem: BGH, a. a. O. Rn. 1-7).
Das Landgericht wies die Klage in I. Instanz ab. Auch das OLG Naumburg als Berufungsgericht lehnte in der Folge einen Gesamtschuldnerausgleich ab.
Hierbei kam das OLG Naumburg — aus Sicht des Verfassers richtigerweise — zu der Auffassung, dass im Außenverhältnis sowohl der Arzt als auch das Krankenhaus gegenüber dem Patienten als Gesamtschuldner haften würden. Denn das Behandlungsverschulden des Arztes bei dessen honorarärztlicher Tätigkeit im Krankenhaus sei dem Krankenhaus vertraglich im Rahmen des einheitlichen Krankenhausaufnahmevertrages nach § 278 Satz 1 BGB, deliktsrechtlich nach § 831 BGB zuzurechnen. Zudem hafte der Arzt dem Patienten gegenüber auch aus seiner niedergelassenen Tätigkeit aufgrund des Indikations- und Aufklärungsfehlers. Auch mit dieser Haftung stünde er in einem Gesamtschuldverhältnis mit dem Krankenhaus, denn es bestehe sowohl eine Identität des Leistungsinteresses als auch eine Gleichstufigkeit der Verpflichtungen (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 10).
Nach Auffassung des OLG bestehe ein Ausgleichsanspruch des Krankenhauses im Innenverhältnis der Gesamtschuldner dabei aber nur bei einer Zuordnungsfähigkeit der schadensursächlichen Tätigkeit zur niedergelassenen Tätigkeit des Arztes, die nicht von der Haftpflichtversicherung des Krankenhauses umfasst werde.
Hierzu führte das OLG sodann aus, dass eine solch klare Zuordnung in der vorliegenden Konstellation gerade nicht möglich sei, da bei einem honorarärztlich operierenden Arzt, der in seiner ambulanten Praxis die OP-Indikation stelle und den Patienten aufkläre, eine unteilbare Verbindung mit der späteren stationären Leistung bestehe. Bei Personenidentität zwischen ambulant vorbehandelndem Arzt und honorarärztlichem Operateur liege eine einheitliche Behandlung mit Operationsschwerpunkt vor (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 11).
Aus diesem Grund sei eine klare Trennung der Verantwortlichkeit für die OP-Vorbereitung und die OP-Durchführung nicht möglich, sodass sich eine eindeutige Zuordnung zum Verantwortungsbereich des einen oder des anderen verbiete, wie dies beispielsweise bei personenverschiedenem ambulanten Behandler und stationärem Operateur sei. Das OLG stellte hierbei zudem auf die Patientensicht ab, da diesem klar gewesen sei, dass der Arzt ihn nicht nur ambulant behandele, sondern, dass dieser auch die stationäre Leistung, konkret die OP, erbringen werde und dass die im Rahmen der niedergelassenen Tätigkeit durchgeführten Arbeitsschritte in Vorbereitung der Operation im Krankenhaus erfolgten. Über die OP könne nach Ansicht des OLG auch nicht hinweggedacht werden, da wenn sie nicht stattgefunden hätte, Indikationsstellung und Aufklärung für sich genommen keinen Gesundheitsschaden ausgelöst hätten. Insofern urteilte das OLG, dass das honorarärztliche Haftpflichtversicherungsverhältnis auch für die operationsvorbereitenden ärztlichen Tätigkeiten „ein anderes“ im Sinne des § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimme, selbst wenn diese zeitlich und örtlich vorverlagert in der ambulanten Praxis des Honorararztes durchgeführt worden seien (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 11).
Diese Ausführungen des OLG Naumburg bedeuten mit anderen Worten: die ambulanten Tätigkeiten des Arztes und seine honorarärztliche Tätigkeit stellen in dieser Konstellation eine einheitliche Behandlung dar, sodass auch die ambulanten Tätigkeiten bei Personenidentität unter den vereinbarten Betriebshaftpflichtversicherungsschutz des Krankenhauses fallen.
Entscheidung des BGH
Der BGH bestätigte zwar die OLG-Entscheidung im Ergebnis, jedoch hielt er die höchst brisante Frage, ob die zeitlich und örtlich vorgelagerten Behandlungsteile im Rahmen der niedergelassenen Tätigkeit des Honorararztes einem einheitlichen Behandlungsgeschehen mit Operationsschwerpunkt und damit als untrennbare Einheit insgesamt der honorarärztlichen Tätigkeit zuzuordnen sind, nicht für erforderlich.
Der BGH bestätigte dabei zunächst noch einmal die oben genannten Haftungsgrundlagen und die bestehende Gesamtschuldnerschaft zwischen Krankenhaus und Arzt.
Im Hinblick auf die Gesamtschuld führte der BGH aus, dass jedoch zwischen dem Krankenhaus und dem Arzt nur ein einheitliches Gesamtschuldinnenverhältnis bestehe. Er lehnte nämlich eine gesonderte Gesamtschuld im Sinne des § 421 BGB ab, d. h. der Arzt haftet hier nicht zusätzlich wegen der schuldhaften Verletzung ärztlicher Pflichten im Rahmen seiner niedergelassenen Tätigkeit. Denn der BGH stellte klar, dass durch die Verdopplung der Anknüpfungspunkte für eine Haftung des beklagten Arztes gegenüber dem Patienten die Gesamtschuld zwischen dem Krankenhausträger und dem Arzt nicht um einen zusätzlichen Ausgleichsanspruch aus § 426 Abs. 1 BGB erweitert werde (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 16).
Die Erstattungsansprüche der Haftpflichtversicherung des Krankenhausträgers aus dem Gesamtschuldverhältnis wies der BGH sodann aber aus zwei Gründen zurück:
1. Zum einen verneinte er die Ansprüche, da der Arzt, soweit das Behandlungsverschulden die honorarärztliche Tätigkeit betrifft, im Innenverhältnis nicht ausgleichspflichtig und zudem nicht Dritter i. S. d. § 86 Abs. 1 S. 1 VVG sei.
Denn im konkreten Fall sei eine von der gesetzlichen Grundregel des § 426 Abs. 1 S. 1 BGB abweichende, andere Bestimmung als die hälftige Verpflichtung beider Schuldner getroffen worden. Diese abweichende Bestimmung ergab sich nach Auffassung des BGH vorliegend aus § 6 des Honorararztvertrages zwischen Krankenhaus und Arzt. Denn hierin wurde dem Arzt für den Fall der Verletzung von im Rahmen des Honorararztverhältnisses zu erbringenden ärztlichen Pflichten Haftpflichtschutz gegen Ansprüche von Patienten aus zivilrechtlicher Haftung zugesagt, ohne dass sich das Krankenhaus einen Rückgriff vorbehalten hätte (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 18).
Folglich wurde die gesetzliche hälftige Ausgleichspflicht durch die Regelung im Honorararztvertrag in Verbindung mit dem vereinbarten Versicherungsschutz des Krankenhauses abgeändert.
Nachdem sich der Versicherungsschutz des Krankenhauses somit jedenfalls auch auf die honorarärztliche Tätigkeit erstreckte, sei der Arzt als versicherte Person anzusehen und damit jedenfalls nicht Dritter im Sinne des § 86 Abs. 1 Satz 1 VVG, sodass ebenso hiernach schon kein Anspruch übergehen könne (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 19).
2. Hinsichtlich des im niedergelassenen Bereich erfolgten Behandlungsverschuldens sah der BGH einen Fall der Mehrfachversicherung, weswegen er den Ausgleichsanspruch der klagenden Haftpflichtversicherung insoweit jedenfalls wegen des Vorrangs des Ausgleichs unter den Haftpflichtversicherern gemäß § 78 Abs. 1 und 2 VVG verneinte.
Hierzu stellte der BGH fest, dass der Arzt für Behandlungsfehler bei seiner niedergelassenen Tätigkeit nach den allgemeinen Grundsätzen selbst hafte. Soweit diese Fehler (hier fehlerhafte Indikation und Aufklärung) mitursächlich für den später durch die fehlerhafte OP eingetretenen Schaden des Patienten geworden sein sollten, hafte der Arzt gegenüber dem Patienten daher schon aus diesem vorgelagerten Fehlverhalten grundsätzlich in voller Höhe. Dieses eigene Haftungsrisiko unterfiele dem Versicherungsschutz bei seiner Haftpflichtversicherung für den niedergelassenen Bereich, sodass dieser Versicherungsschutz insoweit neben den Versicherungsschutz durch das Krankenhaus trete.
Das Versicherungsinteresse des Arztes, nämlich die Absicherung vor Vermögenseinbußen durch eine Belastung mit Schadensersatzansprüchen des Patienten, sei auf Basis der vom OLG vorgenommen tatsächlichen Annahmen somit doppelt abgedeckt. Nämlich durch die eigene Haftpflichtversicherung und durch die auf ihn ausgedehnte Haftpflichtversicherung des Krankenhauses. Wenn jedoch das identische Interesse gegen die identische Gefahr mehrfach haftpflichtversichert sei, so liege aus Sicht des BGH ein Fall des § 78 Abs. 1 Alternative 2 VVG vor, der einen Innenausgleich zwischen den Haftpflichtversicherern bedingt. Dies gelte nach Meinung des BGH auch dann, wenn sich die Mehrfachversicherung nur für eine Schnittmenge bestimmter Tätigkeiten (hier: ambulante Vorbereitungsmaßnahmen für eine spätere stationäre operative Behandlung) ergäbe. Folglich habe der Innenausgleich zwischen den Haftpflichtversicherern, wenn keine Subsidiaritätsklauseln vorliegen, Vorrang vor einem Regress gegen den Arzt nach § 86 Abs. 1 VVG (vgl. zu alldem: BGH, a. a. O., Rn. 20-22). Dies hatte hier konkret zur Folge, dass der Arzt schon nicht passivlegitimiert und damit nicht richtiger Beklagter des Anspruches war. Die Haftpflichtversicherung des Krankenhauses hätte ihren Anspruch auf Gesamtschuldnerausgleich damit allein gegenüber der Haftpflichtversicherung des Arztes geltend machen müssen.
Für die honorarärztlich tätigen Ärzte wäre zwar nach Ansicht des Verfassers eine klare Bestätigung der OLG Auffassung durch den BGH sicherlich wünschenswert und erfreulich gewesen, da dies zu einem erweiterten Haftungsrisiko der Krankenhausträger geführt hätte. Sofern nämlich im jeweils konkreten Einzelfall die honorarärztliche Tätigkeit durch die Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses abgedeckt wäre, hätte die Rechtsprechung des OLG Naumburg aus Sicht des Verfassers in der Folge bedeutet, dass selbst bei einem Behandlungsfehler ausschließlich im niedergelassenen Bereich, also beispielsweise wie hier bei der Indikationsstellung oder der Aufklärung, dies von der Haftpflichtversicherung des Krankenhausträgers gedeckt gewesen wäre, obwohl bei der eigentlichen Behandlung im Krankenhaus kein Fehler unterlaufen war. Allerdings hätte dies als mögliche Konsequenz aus Sicht der Krankenhausträger auch zu einer Reduzierung von Kooperationen mit Honorarärzten führen können, was regelmäßig aus Sicht der Ärzteschaft nicht wünschenswert ist.
2. 2) totaler Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag
In dieser Konstellation wird ein Behandlungsvertrag zwischen Krankenhausträger und Patient über allgemeine Krankenhausleistungen und Wahlleistungen sowie zusätzlich ein gesonderter, i. d. R. konkludenter Vertrag zwischen dem Arzt und dem Patienten über die Erbringung ärztlicher Leistungen geschlossen. Allerdings ist diese Vertragsgestaltung für nicht festangestellte Honorarärzte nicht mehr rechtlich zulässig, da die gefestigte BGH-Rechtsprechung die Erbringung und Abrechnung wahlärztlicher Leistungen durch diese verbietet (vgl. BGH, Urteil v. 16.10.2014 – III ZR 85/14; ders. Urteil vom 10.01.2019 – III ZR 325/17).) Insofern sind weitere rechtliche Ausführungen hierzu aus Sicht des Verfassers nicht veranlasst.
2. 3) gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag
Zum einen kommt ein Behandlungsvertrag zwischen dem Krankenhausträger und dem Patienten über allgemeine Krankenhausleistungen (Unterbringung, Verpflegung, pflegerische Versorgung und ärztliche Versorgung, soweit sie nicht zum Fachgebiet des externen Arztes gehört) zu Stande. Zum anderen wird zusätzlich ein Behandlungsvertrag zwischen dem externen Arzt und seinen eigenen Patienten über ärztliche Leistungen seines Fachgebiets abgeschlossen. Als klassisches Beispiel ist hier der Belegarztvertrag zu nennen. Eigentlich ist auch hier nicht von einem „Honorararzt“ i. S. d. Definition gemäß Ziffer 1. zu sprechen, da der Arzt ja gerade keine ärztlichen Leistungen für das Krankenhaus erbringt, sondern eigene ärztliche Leistungen gegenüber seinen eigenen Patienten.
Bei einer derartigen Kooperation haftet der Arzt aus dem Behandlungsvertrag gegenüber dem Patienten sowohl für seine eigenen Fehler als auch für fremde Fehler des von ihm herangezogenen Personals (z. B. der von ihm angestellten Hilfspersonen oder des nichtärztlichen und ärztlichen KH-Personals, soweit er sich dieses zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten aus dem Behandlungsvertrag bedient, da diese wiederum juristisch als Erfüllungsgehilfen des Arztes gemäß § 278 BGB gelten). Bei dieser Kooperationsform ergibt sich somit aufgrund der Haftungserweiterung auch ein erhöhtes Haftungsrisiko für den Arzt. Der Krankenhausträger haftet dabei lediglich aus dem mit dem Patienten geschlossenen Behandlungsvertrag für Fehler seiner Krankenhausärzte, die nicht zum Fachgebiet des Arztes gehören sowie seines Pflegepersonals, das nicht von ihm hinzugezogen wurde.
Haftungsschuldner im Verhältnis Einrichtung + Honorararzt gegenüber Patient (= Außenverhältnis)
Im Fall eines vom Honorararzt verursachten Behandlungsfehlers ist grundsätzlich eine gesamtschuldnerische Haftung von medizinischer Einrichtung (aus Vertrag und ggf. Delikt) und Honorararzt (stets aus Delikt und ggf. aus Vertrag) im Außenverhältnis gegenüber dem Patienten gegeben.
Der medizinischen Einrichtung wird dabei das Verschulden des Honorararztes entweder aus Vertrag gemäß § 278 BGB aufgrund Erfüllungsgehilfeneigenschaft oder nach § 831 BGB deliktsrechtlich aufgrund Verrichtungsgehilfeneigenschaft zugerechnet.
Die Haftung von medizinischer Einrichtung und Honorararzt als Gesamtschuldner nach § 421 BGB bedeutet, dass der Patient im Falle eines Behandlungsfehlers sowohl gegenüber der Einrichtung als auch gegenüber dem Honorararzt etwaige Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Denn im Rahmen einer Gesamtschuldnerschaft kann der Patient Schadensersatz nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern, wobei er die Leistung insgesamt nur einmal beanspruchen kann. In der Regel werden damit die Einrichtung und der Honorararzt nebeneinander in Anspruch genommen. Dem Patienten stehen somit im Außenverhältnis zwei Schuldner zur Verfügung, an die er sich im Falle eines Schadens halten kann.
Eine vertragliche Abbedingung oder Begrenzung der Gesamtschuldnerschaft betreffend das Außenverhältnis gegenüber dem Patienten zwischen medizinischer Einrichtung und Honorararzt ist rechtlich nicht möglich, da dies einen unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter darstellen würde.
Haftungsverhältnis zwischen medizinischer Einrichtung und Honorararzt (= Innenverhältnis)
Die Haftung im Innenverhältnis, also ob beispielsweise die medizinische Einrichtung den Honorararzt von einer Haftung im Rahmen seiner honorarärztlichen Tätigkeit freizustellen hat oder der Honorararzt hierfür ein Ausgleich zu leisten hat, ist stets Frage der Regelungen im Honorararztvertrag zwischen Krankenhausträger und Honorararzt. Auf die Anspruchsgeltendmachung durch den Patienten haben diese Regelungen im Innenverhältnis aber, wie bereits erläutert, keine Auswirkungen.
Ebenso ist aus ärztlicher Sicht die Einbeziehung honorarärztlicher Tätigkeit in die Betriebshaftpflichtversicherung der medizinischen Einrichtung zwingend im Kooperationsvertrag zu regeln und durch Einblick in die Versicherungsunterlagen zu prüfen. Die Mitversicherung der honorarärztlichen Tätigkeit in der Betriebshaftpflichtversicherung der medizinischen Einrichtung ist aus juristischer Sicht des Verfassers für Honorarärzte unbedingt anzuraten.
Dabei ist Honorarärzten ebenfalls zwingend zu empfehlen, auch darauf zu achten, dass im Kooperationsvertrag keine Vereinbarung dahingehend getroffen wird, dass sich die medizinische Einrichtung einen Regress gegenüber dem Honorararzt vorbehält.
FazitNiedergelassenen Ärzten, die in einer medizinischen Einrichtung honorarärztlich tätig sind, insbesondere im Rahmen von § 2 Abs. 1, 2 KHEntgG in einem Krankenhaus Regelleistungen erbringen, sollten deshalb aus juristischer Sicht des Verfassers zwingend ein Augenmerk darauf legen, dass die honorarärztliche Tätigkeit von der Haftpflichtversicherung der Einrichtung umfasst ist und dass dies auch im Honorararztvertrag so vereinbart wird. Ferner sollte ein Rückgriffsvorbehalt zu Gunsten der Einrichtung nicht vereinbart werden. Sofern bezüglich vorgenannter Punkte kein ausreichender Versicherungsschutz der Betriebshaftpflichtversicherung der medizinischen Einrichtung festgestellt werden kann, ist dem Honorararzt dringend anzuraten, eine eigene Haftpflichtversicherung für die honorarärztliche Tätigkeit abzuschließen und auch auf einen ausreichenden Versicherungsschutz der niedergelassenen Tätigkeit zu achten. |
Heberer J: Wer haftet für den Honorararzt? Juli; 9(07): Artikel 04_06.