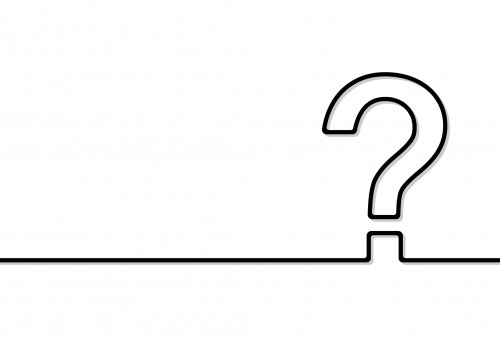Frage:
Ein Chefarzt fragt an, ob dem Patienten ein bestimmter Zeitraum als Bedenkzeit zwischen Aufklärung und Einwilligung gewährt werden muss, oder ob der Patient auch unmittelbar nach der Aufklärung bzw. durch späteres Erscheinen zum Eingriff rechtswirksam in diesen einwilligen kann.
Antwort:
Das OLG Bremen hatte im November 2021 für eine aufsehenerregende Entscheidung unter Klinikträgern, Ärzten und Fachanwälten für Medizinrecht gesorgt, indem es zum einen die Auffassung vertrat, dass die Einwilligung eines Patienten unwirksam sei, wenn diese unmittelbar nach dem Aufklärungsgespräch erteilt werde, weil dem Patienten entgegen § 630e Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BGB keine Bedenkzeit zwischen der Aufklärung über die Risiken des Eingriffs und der Entscheidung über die Einwilligung eingeräumt werde. Zum anderen war es der Ansicht, ein Patient könne auch nicht konkludent dadurch in eine Operation einwilligen, wenn er sich drei Tage nach dem Aufklärungsgespräch zur stationären Aufnahme in die Klinik begibt, um die Operation durchführen zu lassen.
Dieses Urteil hat jedoch – nach Meinung des Verfassers glücklicher- und richtigerweise – keine Bestandskraft erlangt, da der BGH diesen beiden Rechtsauffassungen des OLG Bremen nunmehr entschieden eine Abfuhr erteilt hat. Am 20.12.2022 urteilte der BGH hierzu wie folgt (vgl. zu Nachfolgendem: BGH, Urteil vom 20.12.2022 – VI ZR 375/21):
Grundsätzlich ist keine Bedenkzeit zwischen Aufklärung und Einwilligung erforderlich
Mit seiner Beurteilung, dass eine Einwilligung nicht sofort nach der Aufklärung erteilt werden könne, überspannt das OLG Bremen aus Sicht des 6. BGH-Senats den Wortlaut des § 630e Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BGB und stellt überzogene Anforderungen an die der Behandlungsseite obliegenden Pflichten zur Einholung einer Einwilligung. Die Bestimmung enthält kein Erfordernis, wonach zwischen Aufklärung und Einwilligung ein bestimmter Zeitraum liegen müsste, sondern kodifiziert die bisherige Rechtsprechung, der zufolge der Patient vor dem beabsichtigten Eingriff so rechtzeitig aufgeklärt werden muss, dass er durch hinreichende Abwägung der für und gegen den Eingriff sprechenden Gründe seine Entscheidungsfreiheit und damit sein Selbstbestimmungsrecht in angemessener Weise wahrnehmen kann (vgl. Rn. 16). § 630e Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BGB regelt die Anforderungen an die Aufklärung des Patienten in zeitlicher Hinsicht. Nach dieser Vorschrift muss die Aufklärung so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann. Bereits nach dem Wortlaut und der Stellung im Gesetz bezieht sich die Bestimmung somit allein auf den Zeitpunkt, zu dem das Aufklärungsgespräch stattzufinden hat, das rechtzeitig vor dem Eingriff erfolgen muss. Nach dem Willen des Gesetzgebers zum Patientenrechtegesetz sollte mit dieser Regelung keine inhaltliche Änderung der Rechtslage verbunden sein, sondern lediglich die bisherige Rechtsprechung wiedergegeben werden. Im Einklang mit dieser sieht sie keine vor der Einwilligung einzuhaltende „Sperrfrist“ vor, deren Nichteinhaltung zur Unwirksamkeit der Einwilligung führen würde; sie enthält kein Erfordernis, wonach zwischen Aufklärung und Einwilligung ein bestimmter Zeitraum liegen müsste. Entscheidend ist, ob der Patient unter den jeweils gegebenen Umständen ausreichend Gelegenheit hat, innerlich frei darüber zu entscheiden, ob er sich der beabsichtigten medizinischen Maßnahme unterziehen will oder nicht (vgl. Rn. 18).
Zu welchem konkreten Zeitpunkt ein Patient nach ordnungsgemäßer – insbesondere rechtzeitiger – Aufklärung seine Entscheidung über die Erteilung oder Versagung seiner Einwilligung trifft, ist aus Sicht der Richter seine Sache. Sieht er sich bereits nach dem Aufklärungsgespräch zu einer wohlüberlegten Entscheidung in der Lage, ist es sein gutes Recht, die Einwilligung sofort zu erteilen. Wünscht er dagegen noch eine Bedenkzeit, so kann von ihm grundsätzlich erwartet werden, dass er dies gegenüber dem Arzt zum Ausdruck bringt und von der Erteilung einer – etwa im Anschluss an das Gespräch erbetenen – Einwilligung zunächst absieht. Dass ihn dies – beispielsweise, weil er bereits in Operationsplanungen einbezogen ist und sich einem „Apparat“ gegenübersieht, den er möglichst nicht stören möchte – eine gewisse Überwindung kosten mag, ist seiner Selbstbestimmung zuzuordnen. Der – zum Zwecke einer sinnvollen Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechts – ordnungsgemäß aufgeklärte Patient ist nicht passives Objekt ärztlicher Fürsorge; er ist vielmehr grundsätzlich dazu berufen, von seinem Selbstbestimmungsrecht aktiv Gebrauch zu machen und an der Behandlungsentscheidung mitzuwirken. Es kann von ihm grundsätzlich verlangt werden zu offenbaren, wenn ihm der Zeitraum für eine besonnene Entscheidung nicht ausreicht. Tut er dies nicht, so kann der Arzt grundsätzlich davon ausgehen, dass er keine weitere Überlegungszeit benötigt (vgl. Rn. 19).
Eine andere Beurteilung ist allerdings – sofern medizinisch vertretbar – nach Ansicht des BGH dann geboten, wenn für den Arzt erkennbare konkrete Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass der Patient noch Zeit für seine Entscheidung benötigt. Solche Anhaltspunkte können beispielsweise in einer besonders eingeschränkten Entschlusskraft des Patienten liegen. Gleiches gilt, wenn dem Patienten nicht die Möglichkeit gegeben wird, weitere Überlegungszeit in Anspruch zu nehmen. Das ist etwa – von medizinisch dringenden Behandlungsmaßnahmen abgesehen – dann anzunehmen, wenn der Patient zu einer Entscheidung gedrängt oder „überfahren“ wird (vgl. Rn. 20).
Konkludente Einwilligung durch Erscheinen zur OP
Nach der Rechtsprechung des Senats ist die Einwilligung in den ärztlichen Eingriff kein Rechtsgeschäft, sondern eine Gestattung oder Ermächtigung zur Vornahme tatsächlicher Handlungen, die in den Rechtskreis des Gestattenden eingreifen. Die Vorschriften über Willenserklärungen finden daher keine unmittelbare Anwendung. Der Gesetzgeber hat die Einwilligung nicht als Rechtsgeschäft konzipiert, sondern als frei widerrufliche Disposition über ein höchstpersönliches Rechtsgut (vgl. Rn. 23).
Die Einwilligung in den ärztlichen Eingriff ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Sie kann ausdrücklich erfolgen oder sich konkludent aus den Umständen und dem gesamten Verhalten des Patienten ergeben. Für die Ermittlung des Bedeutungsgehalts des Verhaltens des Patienten ist dabei maßgeblich, wie es aus der Sicht eines objektiven Dritten in der Position des Empfängers – des Behandlers – verstanden werden musste. Entgegen der Auffassung des OLG Bremen setzt die Annahme einer (konkludenten) Einwilligung weder den Widerruf einer zuvor erklärten (unwirksamen) Einwilligung durch den Patienten noch das Bewusstsein des Behandelnden voraus, der Patient erteile erstmals eine wirksame Einwilligung (vgl. Rn. 24). Entscheidend ist, ob der Patient zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Eingriff eine wirksame Einwilligung erklärt und diese nicht widerrufen hat (vgl. Rn. 25).
Nachdem der Patient im konkreten Fall am 01.11.2013 ordnungsgemäß aufgeklärt und sich mehr als zwei Tage später, am 04.11.2013, zum Zwecke der Operation in das Krankenhaus begab, sich stationär aufnehmen ließ und die Operationsvorbereitungen duldete, mussten die behandelnden Ärzte dieses Verhalten dahingehend verstehen, dass er mit der streitgegenständlichen Operation einverstanden war. Mit diesem Verhalten hat er seine bereits am 01.11.2013 unmittelbar nach dem Aufklärungsgespräch erklärte Einwilligung, sofern sie wirksam ist, „bekräftigt“; war diese Einwilligung hingegen unwirksam, weil ihm nicht die erforderliche Überlegungszeit eingeräumt war, sondern er zu ihrer Erteilung gedrängt wurde, so hat er die erforderliche Einwilligungserklärung erstmals am 04.11.2013 abgeben. Der ärztliche Eingriff vom 04.11.2013 war somit aus Sicht der BGH-Richter in jedem Fall durch eine wirksame Einwilligung des Patienten gedeckt (Rn. 26).
Zusammenfassend kann ein Patient damit sofort nach dem Aufklärungsgespräch in eine Behandlungsmaßnahme wirksam einwilligen, wenn er sich zu diesem Zeitpunkt zu einer wohlüberlegten Entscheidung in der Lage sieht. Ist dies nicht der Fall, muss er dies gegenüber dem Arzt kundtun. Die unmittelbar erteilte Einwilligung kann jedoch dann unwirksam sein, wenn für den Arzt erkennbar konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die gegen eine wohlüberlegte Entscheidungsfähigkeit des Patienten zum Einwilligungszeitpunkt sprechen. Keinesfalls sollte der Patient auch zu einer Entscheidung unmittelbar nach dem Aufklärungsgespräch gedrängt oder „überfahren“ werden. Erscheint der Patient sodann jedoch einige Tage nach dem Aufklärungsgespräch zur Durchführung der Maßnahme, dann erteilt er hiermit jedenfalls konkludent seine Einwilligung.
Für Klinikträger und Ärzte ist diese BGH-Entscheidung höchst erfreulich, da ansonsten erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Praxis- und Klinikabläufe zu befürchten gewesen wäre. Aber auch die Mündigkeit der Patienten wird hierdurch nicht mehr in Frage gestellt.
Heberer J: F+A: Bedenkzeit zwischen Aufklärung und Einwilligung. 2023 Mai; 13(05): Artikel 04_09.